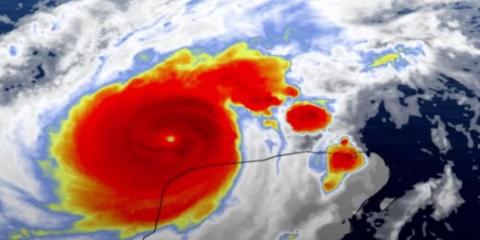1. Ein zweites Bundespräsidialamt für 205 Millionen Euro
Das Schloss Bellevue sowie das dazugehörige Verwaltungsgebäude müssen dringend saniert werden. Deshalb entsteht im Berliner Regierungsviertel ein Büroneubau – unweit entfernt vom Bundeskanzleramt und dem Bundesinnenministerium. Dieser Neubau soll der zeitweisen Unterbringung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seines Mitarbeiterstabs dienen. Kostenpunkt: 205 Millionen Euro.
Spätestens 2026 sollen die Bauarbeiten am maroden Verwaltungsgebäude beginnen. Heißt: Der Ersatzneubau für den Bundespräsidenten und seinen Stab muss 2025 fertiggestellt werden, damit sie ihn ab Frühjahr 2026 für vorerst fünf Jahre nutzen können. Offiziell wird das Bundespräsidialamt 2.0 der Öffentlichkeit als "Bürogebäude für Bundesministerien" präsentiert. Es soll demnach auch von anderen Bundesministerien verwendet werden können. Um welche es sich handelt und wie oft sie das Gebäude nutzen werden, steht allerdings nicht fest.
Insgesamt soll es 160 Büros für 240 Arbeitsplätze geben. Darüber hinaus ist eine Cafeteria sowie eine Vollküche für die Bewirtung von Staatsgästen geplant. Auch repräsentative Empfangs- und Veranstaltungsräume soll es in dem Büroneubau geben. "In Anbetracht der enormen Finanznöte des Bundes zeigt dieser Eifer abermals keinen souveränen Umgang mit Steuergeld, zumal eine konkrete Anschlussnutzung des Büroneubaus bisher ungeklärt ist", kritisieren die Schwarzbuchautoren. Der Bund habe nicht in Erwägung gezogen, dass man das Personal des Präsidialamtes auch aufteilen oder einen kleineren Neubau hätte errichten können.
2. Verteidigungsressort geht mit Schlauchbooten unter
Dem Kommando Spezialkräfte der Marine (KSM) stehen lediglich veraltete Einsatzboote zur Verfügung, die dringend ausrangiert werden müssen. Schon im Jahr 2020 hat man sich mit einer Ersatzbeschaffung auseinandergesetzt, die alles andere als nach Plan verlief. "Vorgegeben war die Beschaffung von neun Festrumpfschlauchbooten bis 2024", teilte das Verteidigungsministerium auf Nachfrage des Bundes der Steuerzahler mit.
Die neuen Boote sollten schneller sein, eine höhere Sicherheit aufweisen und dazu noch weiter schwimmen können. Das Beschaffungsamt der Bundeswehr arbeitete intensiv daran, um die Anforderungen und Spezialwünsche zu erfüllen. "Dabei schien bei den Beamten der kurze Beschaffungsweg mit Blick auf bereits marktgängige und bewährte Spezialboote eine untergeordnete Rolle zu spielen", schreiben die Schwarzbuchautoren.
Obwohl renommierte Werften aufgrund der übertriebenen Leistungsbeschreibung wenig Verständnis zeigten und schließlich abwinkten, hielt das Ressort an den Vorstellungen fest. Letztendlich blieb nur noch ein Anbieter übrig. Im Sommer 2022 wurde der Kauf im Haushaltsausschuss des Bundestags schließlich beschlossen – zunächst ging es um neun Boote mit einer Einsatzdauer von zehn Jahren für 35 Millionen Euro.
Das Problem: Die letzte verbliebene Firma sagte auch noch ab, der Vertrag wurde im April 2023 gekündigt. Es sei technisch unmöglich, die Anforderungen umzusetzen, teilten sie mit. Bis dahin hatte man bereits 687.000 Euro für das Projekt ausgegeben. Die Schwarzbuchautoren kritisieren: "Über Jahre hinweg brütet ein Amt über die Beschaffung von einigen Schlauchbooten, und als Ergebnis kommt heraus: Wir können es nicht!" Nun müsse die KSM "deutlich länger auf neue Einsatzboote warten und sitzt sinnbildlich auf dem Trockenen".
3. Das Desaster um die Pkw-Maut
Schon seit dem vergangenen Jahr ist klar, dass das Bundesverkehrsministerium dem gekündigten Betreiberkonsortium eine Entschädigung zahlen muss. Grund dafür ist das politische und finanzielle Desaster rund um die geplatzte Pkw-Maut. Die fällige Entschädigung: 243 Millionen Euro. Darauf haben sich der Bund und das klagende Konsortium geeinigt. Diese Summe müssen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler aufbringen.
Dazu kommen weitere Kosten wie für die Rechtsstreitigkeiten, die organisatorische Vorbereitung der Mauteinführung und die Rückabwicklung. Insgesamt belaufen sich die Ausgaben also auf mehr als 300 Millionen Euro, schreiben die Schwarzbuchautoren. Die Pkw-Maut – ein Prestigeprojekt der CSU in der damaligen Bundesregierung – war im Juni 2019 vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als rechtswidrig gestoppt worden.
"Insgesamt zeigt das Debakel, dass es notwendig ist, Steuergeld effektiver zu schützen: durch strengere gesetzliche Regeln bis hin zur Klärung von Regressansprüchen", meinen die Schwarzbuchautoren. Steuerzahlerinnen und Steuerzahler seien "empört – und das zu Recht". Die Kosten in Höhe von 243 Millionen Euro würden den Investitionsmitteln entsprechen, "die der Bundeshaushalt 2023 für die Attraktivitätssteigerung und Barrierefreiheit von Bahnhöfen bereitstellt", heißt es weiter.
4. Teure Spartipps
Zur Verringerung des Energieverbrauchs hat die Bundesregierung im Jahr 2022 eine Kampagne unter dem Titel "80 Millionen gemeinsam für den Energiewechsel" gestartet. Sie soll bis 2025 laufen und könnte bis dahin mehr als 83 Millionen Euro kosten. Das Problem: Der "Neuigkeitswert der einen oder anderen Botschaft der Kampagne" sei "fraglich", schreiben die Schwarzbuchautoren.
Unter anderem geht es darum, die Duschzeit auf höchstens fünf Minuten zu beschränken, um Warmwasser und Energie zu sparen. "Das dürfte die wenigsten Bürger überraschen", heißt es im Schwarzbuch weiter. Bereits im vergangenen Jahr hätten diese "Empfehlungen zum Energiesparen und der Steigerung der Energieeffizienz" rund 38,8 Millionen Euro gekostet, wie eine Anfrage des Bundes der Steuerzahler beim Bundeswirtschafts- und Klimaschutzministerium ergab.
Finanziert wird die Kampagne teilweise über Notlagenschulden aus dem Sondervermögen "Klima- und Transformationsfonds". Das Fazit des Bundes der Steuerzahler: "Angesichts der unklaren Wirkung auf das eigentliche Ziel des Energiesparens hätte das Geld für die Kampagne besser eingespart werden sollen – zumal diese Ausgaben auch noch über Schulden finanziert werden."
5. Hamburg zahlt 4 Millionen Euro Miete – für nichts
In einem neuen Gebäude sollten die verschiedenen Standorte der Hamburger Staatsanwaltschaft zusammengelegt werden. Der Mietvertrag dafür wurde bereits im Dezember 2019 unterschrieben. Der Umzug sollte schließlich im September 2022 erfolgen, konnte aufgrund von nicht fertiggestellter Räume aber noch nicht durchgeführt werden. Nun verlangt der Eigentümer für die Zeit seit dem 1. September 2022 eine finanzielle Entschädigung für die entgangenen Mieteinnahmen.
Pro Monat kostet die Miete 392.533,08 Euro. Bis Juli 2023 entstanden also Kosten von 4 Millionen Euro. Eine kurzfristige Lösung bahnt sich indes nicht an, denn die Justizbehörde offenbarte, dass die Baumaßnahmen noch nicht abgeschlossen seien. Laut Schwarzbuch heißt das: "Die Stadt zahlt weiter fast 400.000 Euro ‚Nutzungsausfallentschädigung‘ pro Monat, ohne das Gebäude zu nutzen, und zusätzlich die Miete für die aktuell genutzten Gebäude."
Weiter teilte die Justizbehörde mit, dass die "Entscheidung für dieses Projekt in der letzten Legislatur getroffen" worden sei: "Die aktuelle Behördenleitung hat das Projekt also von ihrer Vorgängerin geerbt. Es hatte sich herausgestellt, dass das Projekt in der Vergangenheit nicht gut gemanagt wurde."
Das Fazit der Schwarzbuchautoren fällt dementsprechend hart aus. Eine solche "Panne würde sich niemand leisten, der mit seinem eigenen Geld dafür geradestehen müsste", schreiben sie in ihrem Buch. Die Verantwortlichen seien "überfordert, einen Umzug zu planen".
6. Hohen Sanierungsbedarf erst nach Abschluss des Mietvertrags erkannt
Der Landkreis Bodenseekreis mietete im Jahr 2016 ein Hotel im Ort Sipplingen an, um Geflüchtete unterzubringen. Abgeschlossen wurde ein Mietvertrag über neun Jahre bis 28. Februar 2025 – ohne Ausstiegsklausel. Das Problem: Erst nach der Unterzeichnung ist aufgefallen, dass hohe Kosten für die Sanierung nötig werden.
Also ließ man für 40.000 Euro ein Gutachten anfertigen, das erforderliche Sanierungskosten von 532.600 Euro aufdeckte. Das Landratsamt entschied sich daraufhin gegen eine Sanierung des Hotels. Somit mussten pro Jahr fast 80.000 Euro Miete gezahlt werden, genutzt werden konnte das Objekt aber zu keiner Zeit.
Nach einer Klage des "Südkuriers", der über den Fall berichtete, musste der Landkreis die Zahlen offenlegen. Dabei kam heraus, dass vom 1. März 2016 bis zum 31. Mai 2021 insgesamt 487.931 Euro fällig wurden. Danach haben sich die Verantwortlichen mit den Eigentümern des Hotels auf eine Aufhebungsvereinbarung geeinigt – für zusätzliche 288.000 Euro. Steuerzahlerinnen und Steuerzahler kostete der Fall in Baden-Württemberg also insgesamt mehr als 800.000 Euro.
Die Schwarzbuchautoren kritisieren, dass man die "Räumlichkeiten dringend vor und nicht nach der Unterzeichnung des langfristigen Mietvertrags" hätte überprüfen müssen.