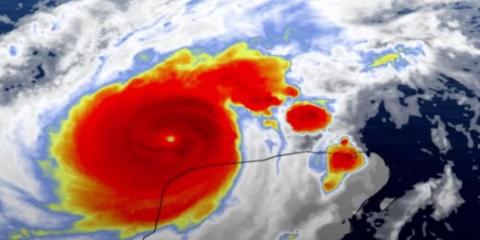Heute, ein und ein dreiviertel Jahr später, herrscht in ihrer Heimat weiter Krieg, sie ist weiter in Deutschland. Ihre insgesamt fünf Kinder, der älteste ist elf, gehen in Schulen und Kitas, sie selbst belegt bis April einen Sprachkurs. Sie hat einen Master-Abschluss, hat an der Universität und in Architekturbüros gearbeitet. Sie selbst möchte bleiben – "und ich wünsche mir nichts sehnlicher, als hier in meinem Beruf als Architektin zu arbeiten". Bislang aber, solange sie Deutsch lernt, bezieht sie wie rund 700.000 weitere Geflüchtete aus der Ukraine Bürgergeld – und ist damit Teil eines aufgeheizten politischen Streits geworden, der sich um die Frage dreht: Hält das Bürgergeld ukrainische Geflüchtete von der Arbeit ab? Sind es diese Leistungen, die dafür sorgen, dass in anderen Ländern deutlich mehr Ukrainerinnen und Ukrainer arbeiten?
Der Druck kommt dabei insbesondere aus den Landkreisen. "Nach meiner Einschätzung wirkt das Bürgergeld in Bezug auf eine mögliche Arbeitsaufnahme eher hinderlich", sagt der Tübinger Landrat Joachim Walter (CDU). "Insbesondere bei weniger hoch bezahlten Tätigkeiten rechnen die Menschen nachvollziehbarerweise und entscheiden sich eher fürs Bürgergeld als für eine Arbeitsaufnahme, die nicht mehr einbringt als das Bürgergeld." Als Beweis dienen ihm, wie vielen anderen Politikerinnen und Politikern derzeit auch, die Niederlande – wo "mehr als zwei Drittel der erwerbsfähigen Ukrainerinnen und Ukrainer arbeiten", im Gegensatz zu gerade mal 20 Prozent in Deutschland. "Solche Zahlen", fordert Walter, "müssen uns aufhorchen lassen." CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt ist sich sicher, ebenfalls mit Verweis auf die Niederlande: "Deutschland bietet die falschen Anreize." Aber stimmen sie auch?
Tatsächlich hat die Bundesregierung ukrainische Geflüchtete bessergestellt als Schutzsuchende aus anderen Ländern. Bereits zum 1. Juni vergangenen Jahres hatte die Ampelkoalition entschieden, dass sie Bürgergeld statt Asylbewerberleistungen erhalten – also 502 statt 410 Euro. Außerdem dürfen sie von Anfang an in privaten Wohnungen, statt in Gemeinschaftsunterkünften leben. Die Regeln waren gedacht als Geste der Solidarität mit den Menschen aus der Ukraine, erlassen unter dem Eindruck des kollektiven Schocks nach dem russischen Überfall. Inzwischen jedoch fällt der Blick deutlich nüchterner aus. "Damit hat man es ihnen zu nett gemacht", befand Matthias Jendricke, SPD-Landrat aus dem thüringischen Nordhausen, zuletzt im "Spiegel". "Dann ist einfach das Sofa gemütlicher als der Deutschkurs."
Verschärft haben den Streit zudem die Haushaltsnöte der Ampel nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Die Koalition muss massiv sparen. Noch verhandelt die Koalition, wo das geschehen soll. Aber Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) merkte in einer "Fußnote" vor Kurzem schon mal an, welche Posten er für auffällig hält. Das Bürgergeld für ukrainische Flüchtlinge jedenfalls würde im kommenden Jahr "mit 5,5 Milliarden bis sechs Milliarden Euro zu Buche" schlagen. Eine Summe, die deutlich niedriger ausfiele, wenn mehr Ukrainer arbeiten würden.
Vor allem Unions- und FDP-Politiker hantieren deshalb in Interviews und Talkshows gerne mit dem Verweis auf die Niederlande, das vermeintlich gelobte Land der ukrainischen Arbeitsmarktintegration. Tatsächlich bescheinigt eine Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung den Niederlanden den Spitzenplatz in Europa, mit einer Beschäftigtenquote von 70 Prozent. Die Zahl ist eine Art Joker in der Debatte um mehr Druck auf ukrainische Flüchtlinge, wie ihn auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) Ende Oktober angekündigt hat.
Tatsächlich jedoch ist man in den Niederlanden selbst bass erstaunt über diese Vorbildrolle im deutschen Diskurs. Kasper Otten jedenfalls vom Wissenschafts- und Daten-Center WODC, einem unabhängigen Institut in Den Haag, das auch die niederländische Regierung berät, verweist auf die Zahlen der nationalen Statistikbehörde vom Mai dieses Jahres: Demnach arbeiten in den Niederlanden lediglich 49 Prozent der männlichen und 51 Prozent der weiblichen Ukraine-Flüchtlinge. Der Unterschied zu Deutschland, wo laut dem neuesten Zuwanderungsbericht des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 24,9 Prozent der Ukraine-Flüchtlinge arbeiten, ist damit deutlich geringer. Und auch sonst rät Otten zu einem nüchternen Blick.
So zeigen die Daten, dass Ukrainerinnen und Ukrainern in den Niederlanden vor allem in niedrig qualifizierten Jobs unterkommen – obwohl viele von ihnen über einen akademischen Abschluss verfügen. "Wir sehen, dass der durchschnittliche Stundenlohn von Ukrainern hier ungefähr 15 Euro beträgt – mehr als der Mindestlohn also, aber deutlich unter dem allgemeinen Durchschnittslohn von rund 25 Euro." Die Sozialleistungen in den Niederlanden seien mit 200 bis 400 Euro pro Person zwar deutlich niedriger als in Deutschland. Ob die Ukrainer deshalb verstärkt Jobs annähmen, sei jedoch unklar – ihre Motivation sei generell sehr hoch.
So verfolgten die Niederlande mit unbürokratischen Vorschriften generell einen "Working first"-Ansatz, während zum Beispiel Deutschland zunächst auf verpflichtende Sprach- und Integrationskurse setzt, damit die Geflüchteten in ihren angestammten Berufen arbeiten könnten. "Wir wissen noch nicht, welches Modell langfristig zu einer besseren Eingliederung in den Arbeitsmarkt führt", sagt Otten. "Deshalb ist es zu früh, die Niederlande als Modell für eine erfolgreiche Integration in den Arbeitsmarkt anzuführen." Auch die Professorin Yulia Kosyakova, Forschungsbereichsleiterin am IAB, hält den deutschen Weg nicht per se für erfolglos: Die Zahlen seien mit denen der Niederlande schlicht nicht vergleichbar – schon weil in Deutschland der Anteil der Frauen, die wiederum zunächst Betreuungsplätze für ihre Kinder bräuchten, höher sei als in den Niederlanden.

Registrierung und Gründung einer maltesischen Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Und auch der Fall Mariia T., der Architektin aus Kiew, zeigt, dass die Sozialleistungen keineswegs die soziale Hängematte sind, als die sie gerne gezeichnet werden. Das Jugendamt forderte die 40-Jährige auf, eine Vaterschaftsanerkennung von ihrem früheren Lebensgefährten beizubringen. Als sie sich weigerte, habe das Jobcenter einen Teil der Leistungen gestrichen. Sie habe mit dem Vater ihrer Kinder keinen Kontakt mehr, sagt Mariia T.. "Und wie sollte ich jetzt an die Front fahren und ihn suchen?"
Für sich erhält Mariia T. deshalb jetzt noch 150 Euro im Monat. In ihrer Verzweiflung überlege sie nun, den Sprachkurs abzubrechen und einen einfachen Job anzunehmen, um etwas dazuzuverdienen. "Aber wem ist damit geholfen", fragt sie, "wenn ich jetzt als Putzfrau statt später als Architektin anfange?"