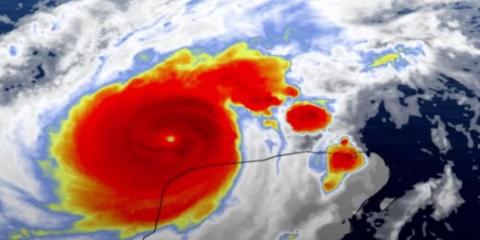Dazu gehörten etwa Dachdecker, Pflegekräfte, Lagerarbeiter, Paketboten, Kassen- und Kitapersonal. "Berufsgruppen, die psychisch oder körperlich hart arbeiten und die ohnehin schon eine vergleichsweise kleine Rente bekommen." Gerade Geringverdienern drohten bei einem höheren Eintrittsalter Abschläge beim Rentenanspruch, weil sie vielfach nicht bis zum Schluss durchhalten könnten, erklärt Beuttler-Bohn. Zur von vornherein geringeren Rente und den Abschlägen komme noch eine weitere Benachteiligung: "Die Lebenserwartung eines Arbeiters ist im Mittel vier Jahre geringer als die eines Beamten, die eines ärmeren Rentners fünf Jahre geringer als die eines reicheren." Die geringere Rente werde also zudem noch für kürzere Zeit bezogen.
Einer Anfang des Jahres vorgestellten Umfrage zufolge sind die meisten Erwerbstätigen in Deutschland gegen eine Erhöhung des Renteneintrittsalters. Gut zwei Drittel würden demnach lieber mehr in die Rentenkasse einzahlen. Bei den 18- bis 39-Jährigen würden sogar 70 Prozent höhere Beitragszahlungen bevorzugen, wie die Umfrage im Auftrag des Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) ergab. Unbestritten ist, dass das deutsche Rentensystem vor Herausforderungen steht. War nach Daten des Statistischen Bundesamtes 1950 noch jede zehnte Person (10 Prozent) in Deutschland 65 Jahre und älter, lag der Anteil 2021 schon bei mehr als einem Fünftel (22 Prozent). 1950 wurden gut 1,1 Millionen Kinder geboren, 1964 gar knapp 1,4 Millionen, 2022 aber nur noch rund 739 000.
Die Rentenbezugsdauer hat sich in den letzten 60 Jahren annähernd verdoppelt, wie es im "Grünbuch Alternde Gesellschaft II" heißt. Und bis Mitte der 2030er Jahre wird die geburtenstarke Generation der Babyboomer in Rente gehen. Nach Daten des Statistischen Bundesamtes überschreiten auf das Jahr 2021 bezogen rund 13 Millionen Erwerbstätige bis 2036 das Renteneintrittsalter - fast ein Drittel der dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehenden Menschen. Die Folge: Während in den 1950er Jahren sechs Menschen im Erwerbsalter für einen Rentner aufkamen, sind es derzeit noch drei, wie es beim ifo Institut – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung heißt. Im Jahr 2050 werde die Last von nur zwei Menschen zu stemmen sein. "Für eine langfristig tragfähige Finanzierung des Rentensystems kommen wir in Deutschland nicht um eine Verlängerung der Regelaltersgrenze herum", heißt es in dem Buch.
Später in Rente gehen, was bedeutet das für die Gesundheit? Studien zum Zusammenhang von Renteneintrittsalter und Gesundheit sind rar. Eine 2022 vorgestellte Analyse eines Teams um Mara Barschkett vom DIW Berlin zeigt, dass die Rentenreform im Jahr 1999, bei der das Renteneintrittsalter für Frauen von 60 auf 63 Jahre erhöht wurde, negative Gesundheitseffekte hatte. Durch den späteren Rentenzugang nahmen psychische Erkrankungen, Übergewicht und Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems merklich zu. Verbesserungen habe es bei keinem Gesundheitsaspekt gegeben, berichtete das DIW-Team.
Eine im April vorgestellte Studie eines Teams um Han Ye von der Universität Mannheim zu Spanien ergab, dass im Mittel kürzer lebt, wer später in Rente geht. Das Eintrittsalter wurde dort bei der Rentenreform 1967 von 60 auf 65 Jahre angehoben. Der verzögerte Ausstieg erhöhte der Auswertung zufolge das Sterberisiko zwischen dem 60. und 69. Lebensjahr im Mittel deutlich - bei einem ein Jahr späteren Ausstieg zum Beispiel um 4,2 Prozentpunkte. Besonders sichtbar war der Anstieg bei Menschen mit gering qualifizierten, physisch oder psychosozial herausfordernden Tätigkeiten.
Das Team gibt zu bedenken, dass die sozioökonomische Ungleichheit in der Lebenserwartung ohnehin groß ist und in den letzten Jahrzehnten zugenommen hat. Rentenreformen könnten sie weiter verstärken - weil Menschen mit fordernden, weniger anerkannten Jobs besonders von den Folgen einer Altersanhebung betroffen sind und weil ihr finanzieller Spielraum eingeschränkt ist, mit Abschlägen eher in Rente gehen zu können.
Einer 2019 vorgestellten Studie des RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung zufolge profitieren Männer aus manuellen, geringbezahlten Berufen gesundheitlich davon, mit 63 Jahren in den Ruhestand gehen zu können. Bei Gutverdienern zeigte sich kein solcher Effekt. Im Gegenteil: Beendeten Männer mit gut bezahlten Tätigkeiten mit 65 Jahren ihr Berufsleben, stieg die Sterblichkeit kurz nach der Verrentung. Bei Geringverdienern war das in weit geringerem Maße der Fall. Eine mögliche Erklärung sei soziale Isolation im Rentenalter: Gutverdiener verlören mit der Berufstätigkeit auch Prestige und soziale Netzwerke, hatte Studienautor Matthias Giesecke erklärt.
Generell übertünche der Durchschnitt in Studien große individuelle Unterschiede, betont Mara Barschkett, die inzwischen am Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) arbeitet. "Nicht jeder, der auf einmal viel Zeit hat, investiert sie in Sozialkontakte, Hobbys und Gesundheit." Hans-Werner Wahl, Projektleiter am Netzwerk Alternsforschung der Universität Heidelberg, ergänzt, dass viele Menschen Freude daran hätten, länger zu arbeiten. "Mit 70 können 75 Prozent der Berufe so effektiv ausgeübt werden wie von Jüngeren", sagt er. "Ältere machen zwar mehr Fehler, Jüngere aber die gravierenderen."
Es sei wichtig, lebenslang neu stimuliert und gefordert zu werden, etwa für die mentale Leistungsfähigkeit im Alter. "Länger arbeiten ist auf keinen Fall nur als Risiko zu sehen", betont der Alternsforscher. Allerdings sei das Lebenslauf-Modell Bildung-Arbeit-Rente infrage zu stellen. "Davon müssen wir wegkommen", meint Wahl. "Auch mal ein Sabbatical machen zwischendurch, in andere Berufsfelder wechseln. Nicht einen Job machen durchgehend bis zur Rente."
Beim Blick nach vorn kann ein Blick zurück von Nutzen sein. "Mitte des 19. Jahrhunderts war noch die Sechs-Tage-Woche mit Zwölf-Stunden-Tagen üblich", sagt Philipp Frey von der ITAS-Forschungsgruppe Digitale Technologien und gesellschaftlicher Wandel. In den Jahrzehnten darauf sei nicht nur die Arbeitszeit stark verkürzt, sondern das Arbeitspotenzial auch an anderen Stellen stark eingeschränkt worden - vor allem durch das Verbot von Kinderarbeit und die Einführung der gesetzlichen Rente 1889, die das Arbeiten bis zum Tod ablöste.
Jedes Mal habe es aus Unternehmerkreisen geheißen, das sei nicht zu verkraften und werde zu einer immensen Pleitewelle führen, erklärt Frey. "Und das ist nicht passiert, es hat volkswirtschaftlich nicht geschadet." Grund sei eine massiv gestiegene Wertschöpfung pro Arbeitsstunde. "Die durchschnittliche Vollzeitwoche ist heute weniger als halb so lang wie damals, aber wir arbeiten 24 mal so produktiv wie im Kaiserreich." Arbeitszeitverkürzungen seien stets ein starker Treiber für Produktivitätssteigerungen gewesen und hätten technische Innovationen gefördert. Im Gegenzug gelte: "Wenn die Löhne vergleichsweise gering sind, investieren Unternehmen weniger in Technologie."
In Produktivitätssteigerungen sieht Arbeitsforscher Frey einen möglichen Weg aus dem Rentendilemma - ganz ohne Rente mit 70. "Falls wir ein Drittel unseres Erwerbspotenzials durch Babyboomer-Verrentung und demografischen Wandel verlieren, kann man das ohnehin nicht durch ein drei Jahre höheres Renteneintrittsalter auffangen", betont er. "Aber wenn zwei so produktiv arbeiten würden wie heute vier, könnte das die Lücke mehr als überkompensieren."
Wichtig sei zudem eine bessere Verteilung der Arbeit. Bei vielen Maßnahmen zur Steigerung des Arbeitskräftepotenzials gebe es noch Luft nach oben - mit einer Verbesserung des Kitaangebots zum Beispiel, einem Aus für das Ehegattensplitting und mehr Investitionen in Bildung. Migranten erhielten oft keine Arbeitserlaubnis, wenn doch, würden ihre Abschlüsse häufig nicht anerkannt.
Dass Veränderungen etwas bewirken können, zeigen die vergangenen Jahrzehnte: Die Zahl der Menschen im Erwerbsalter sei heute zwar etwas geringer als 1992, die Zahl der rentenversicherungspflichtig Beschäftigten aber um knapp fünf Millionen höher, heißt es von der Deutschen Rentenversicherung Bund. Ursache seien unter anderem die höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen und die Zuwanderung von jüngeren Menschen aus anderen EU-Ländern.
"Es gibt noch eine Menge Möglichkeiten, wo man nur ein bisschen Grips reinstecken muss, um das Potenzial für den Arbeitsmarkt zu heben", betont Frey. Hinzu komme die Möglichkeit, das Rentensystem nach dem Beispiel Österreichs auf eine solide Grundlage zu stellen, wo auch Selbstständige und Beamte in eine Bürgerversicherung für alle einzahlen. Freys Fazit: "Die Rente mit 70 ist eine Scheindebatte."
Der Weg führe aus vielerlei Gründen eher zu einer weiter verringerten Wochen- und Lebensarbeitszeit, ist der Karlsruher Forscher überzeugt. Ein zentraler Faktor sei die Klimakrise. Wirtschaftspolitisch sei derzeit noch immer die zentrale Strategie, sich auf Wachstum zu fokussieren. Das aber könne nur in den ökologischen Ruin führen, sagt Frey. Stattdessen sollten Produktivitätszugewinne für mehr freie Zeit genutzt werden. "Die 40-Stunden-Arbeitswoche beibehalten, das geht gar nicht. Dann könnten wir den Planeten gleich anzünden."