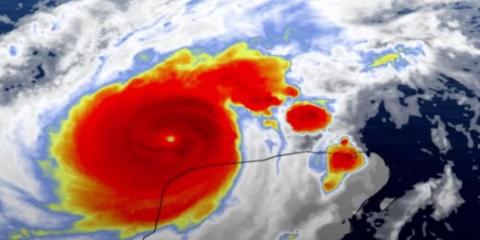Gemeinsam ist man stärker, lautet das Credo, unter dem die EU die zahlreichen Projekte in den vergangenen Jahren auf den Weg gebracht hat. "Die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten ist der Schlüssel zur Stärkung der EU-Verteidigung und der Verteidigungsindustrie", lobte Josep Borrell, Hoher Vertreter für Außen- und Sicherheitspolitik, Mitte des Monats auf einer PESCO-Konferenz. Doch bisher ist die Bilanz verheerend: "In der Vergangenheit konnten die Rüstungsprojekte, an denen mehrere Länder beteiligt waren, keine Synergien oder einen strategischen Mehrwert bringen", stellt Sidonie Wetzig aus dem Brüssler Büro der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) klar. "Es fehlte an politischer Führung und an Druck von außen, effektive Resultate zu erzielen."
Diesen Druck gibt es erst seit Februar 2022 durch Russlands Krieg – und je länger die Kämpfe dauern, umso mehr wird der Krieg zu einem Wettbewerb der Produktionsfähigkeit zwischen der westlichen und der russischen Rüstungsindustrie. Deshalb unterstützt die EU nicht nur die Ukraine, sondern auch die Rüstungsunternehmen ihrer Mitgliedsstaaten.
Die 2012 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnete EU rüstet auf. Mehr und mehr Milliarden stellt Brüssel bereit, um Europas Verteidigung fit für die Zukunft zu machen: Der Europäische Verteidigungsfonds soll Kooperationsprojekte finanzieren, aus dem Topf der Europäischen Friedensfazilität können sich Mitgliedsländer ihre Waffenlieferungen an die Ukraine erstatten lassen. Und in der vergangenen Woche wurde ein EU-Waffenbeschaffungsfonds verabschiedet, um die erschöpften Lagerbestände der Mitglieder aufzufüllen. Das sind nur einige der Finanztöpfe.
Doch auch Geld auszugeben ist schwer: "Die EU-Staaten stehen vor der Frage, ob sie Rüstungsaufträge innerhalb Europas, in die USA oder nach Asien vergeben", sagt Michelangelo Freyrie, der am Institut für Internationale Beziehungen (IAI) in Rom zur europäischen Verteidigungspolitik forscht. "Diese Entscheidungen werden die Verteidigung der nächsten 20 bis 30 Jahre prägen." Polen hat sich zum Beispiel für Panzer aus Südkorea entschieden und wird diese jahrzehntelang nutzen.
Die EU-Staaten stehen noch vor einem weiteren Dilemma, sagt Freyrie: "Entweder sie kaufen jetzt Waffen, die bereits auf dem Markt sind und womöglich nicht die besten sind oder nicht aus Europa kommen, oder sie warten zwei bis drei Jahre, bis sie gemeinsam europäische Systeme entwickelt haben." Wenn die EU-Staaten keine europäischen Waffen kaufen, bedeute dies aber gleichzeitig, dass europäische Firmen zukünftig weniger Geld für gemeinsame Entwicklungen haben. "Wenn man noch ein paar Jahre wartet, büßt man erst einmal kurzfristig Wehrhaftigkeit ein", führt Freyrie aus.
Für EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist die Entscheidung klar: Sie warb bei ihrer Rede für eine europäische Lösung. "Die Zeit für Europa ist gekommen, wieder im großen Maßstab zu denken und das Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen", sagte sie mit viel Pathos in ihrer Rede zur Lage der Union vor wenigen Tagen. Die EU sei auf dem Weg zu einer "Verteidigungsunion", lobte sie.
Verteidigungsunion? "Das ist ein bisschen schöngefärbt", sagt Wetzig. "Die Wirklichkeit sieht ganz anders aus." Einer der Gründe: Nach wie vor spielt die nationale Rüstungsindustrie in den EU-Staaten die maßgebliche Rolle. "Das ist ein großes Problem, denn die Rüstungskonzerne machen sich nur unnötig auf Kosten der Wirtschaftlichkeit Konkurrenz", so die Expertin in Brüssel. "Wir brauchen mehr Kooperation statt Konkurrenz." Vom Idealbild einer europäischen Rüstungsindustrie sei die EU weit entfernt.
Dabei geht es nicht nur um die gemeinsame Bestellung von Waffen und Munition, sondern auch um die gemeinsame Produktion. Der Flugzeugbauer Airbus mit seiner Lieferkette durch mehrere europäische Länder ist für FES-Expertin Wetzig ein gutes Beispiel, wie ein europäisches Projekt funktionieren kann.
Übertragen auf die Verteidigung bedeutet das: Bei einem Panzer kommt das Rohr aus Frankreich, die Elektronik aus Deutschland, und Polen baut alles zusammen. "Im Idealfall ist das nicht nur günstiger, sondern man kann auch mehrere Länder in Europa beliefern. "Eine Fragmentierung der europäischen Rüstungsindustrie können wir uns einfach nicht mehr leisten." Gemeinsam sei alles ein bisschen komplizierter, räumt die Brüsseler Expertin ein. Aber bei Milliardeninvestitionen in die Verteidigung könnten Synergieeffekte genutzt werden, wenn Staaten bei Rüstungsprojekten zusammenarbeiten.
Großaufträge für Panzer und Munition haben dazu geführt, dass sich die europäische Rüstungsindustrie in einem tiefgreifenden Umbruch befindet. Ob jedes Land diesen Umbruch einzeln vollzieht oder ob man die Chance nutzt und sich zusammenschließt, ist die nun anstehende Richtungsentscheidung. Der Europäische Rechnungshof hat bereits in der Vergangenheit kritisiert, dass EU-Geld nicht zu mehr Zusammenarbeit zwischen den Staaten geführt habe. Es habe nur eine Zusammenarbeit zwischen Partnern gegeben, die vorher schon zusammengearbeitet hätte, sagt Wetzig. "Solange es kein Vertrauen unter den Mitgliedstaaten und keine politische Entschlossenheit gibt, haben wir noch keine Verteidigungsunion."
Bisher haben vor allem Italien und Frankreich die europäische Verteidigungspolitik vorangetrieben. Deutschland wähnte sich lange in Sicherheit und rechnete nicht damit, jemals Europa verteidigen zu müssen. Doch der Krieg hat der Berliner Politik schmerzlich vor Augen geführt, wie schlecht es um die deutschen Fähigkeiten bestellt ist: Die Munition reicht nur für zwei Tage Kriegseinsatz, viele Waffensysteme fehlen, und selbst an abhörsicheren Funkgeräten mangelt es in Teilen der Truppe. Nun will Deutschland aufholen. Verteidigungsexperte Freyrie in Rom beobachtet "eine echte Zeitenwende" in Berlin. "Die hohen Auszahlungen aus dem europäischen Verteidigungsfonds zeigen, dass Deutschland zu einem immer wichtigeren Akteur in der Rüstungspolitik wird."
Die EU-Staaten rüsten auf. Einige haben ihre Verteidigungsausgaben auf 3 bis 4 Prozent der Wirtschaftsleistung erhöht, wie zum Beispiel Polen, und europäische Rüstungsprojekte werden mit Nachdruck vorangetrieben. Doch bisher fehlt eine strategische Vision, wo die europäische Verteidigungspolitik außerhalb der Ukraine zum Einsatz kommen soll. Erfahrungen gibt es bisher nur mit Einsätzen zu Konfliktprävention und Konfliktmanagement, etwa bei Missionen unter EU-Mandat in Westafrika. Zudem ist es fraglich, ob die politische Entschlossenheit der EU-Regierungschefs auch nach dem Krieg bleiben wird, schätzt FES-Expertin Wetzig. "Die Gefahr ist groß, dass Europa wieder in alte Gewohnheiten und verteidigungspolitische Kleinstaaterei zurückfällt."
dp/fa