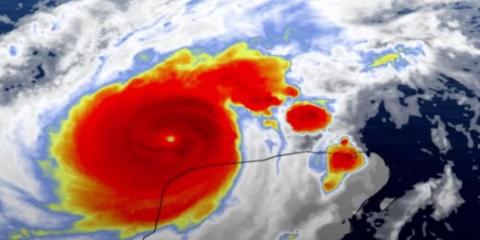Grund für die zurückhaltende Wortwahl war die Haltung von Ländern wie Österreich, Irland und Malta. Sie wollen militärisch neutral bleiben und sind deswegen auch nicht Mitglied der Nato. Der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer sagte am Donnerstag zum Thema Sicherheitsgarantien: "Da ist es für uns als neutrale Staaten klar, dass es diese so nicht geben kann." Österreichs militärische Neutralität ist in einem Bundesverfassungsgesetz aus dem Jahr 1955 geregelt.
Zukünftige Sicherheitszusagen sollen der Ukraine laut der Erklärung dabei helfen, sich langfristig zu verteidigen, Aggressionshandlungen abzuwenden und Destabilisierungsbemühungen zu widerstehen. Wie sie konkret aussehen könnten, wird allerdings nicht erläutert. Theoretisch könnte es zum Beispiel darum gehen, EU-Ausbildungsprogramme für die ukrainischen Streitkräfte oder andere Militärhilfen langfristig fortzusetzen. Kanzler Olaf Scholz äußerte sich am Donnerstag zunächst nur knapp zum Thema Sicherheitsgarantien. "Deutschland ist schon seit langem mit seinen engsten Verbündeten dabei, solche Diskussionen mit der Ukraine zu führen", sagte er. "Das werden wir auch weiter tun."
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat unterdessen die Forderung nach einer baldigen konkreten EU-Beitrittsperspektive für sein Land erneuert. "Die Ukraine hat Einfluss auf die Stärke Europas. Das ist ein Fakt", sagte Selenskyj am Donnerstag in seiner abendlichen Videoansprache. "Und dieses Jahr ist es an der Zeit, diesen und andere Fakten zu nutzen, um die Einheit in Europa zu stärken - angefangen beim Start von Verhandlungen über die EU-Mitgliedschaft der Ukraine." Selenskyj war früher am Tag auch per Video zu einem EU-Gipfel in Brüssel zugeschaltet gewesen.
Die EU hatte die von Russland angegriffene Ukraine vergangenes Jahr offiziell zum Beitrittskandidaten gemacht. Bislang hat Kiew zwei von sieben Voraussetzungen für die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen erfüllt. Dabei geht es etwa um eine stärkere Korruptionsbekämpfung - insbesondere auf hoher Ebene. Im Oktober wird die EU-Kommission darüber entscheiden, ob sie den Staats- und Regierungschefs der EU empfiehlt, Beitrittsgespräche mit der Ukraine aufzunehmen. Das ist jedoch noch keine Garantie für eine Mitgliedschaft.
Die EU-Staaten wollen allerdings die Ukraine stärker bei den Planungen für einen internationalen Friedensgipfel unterstützen. Man werde die diplomatischen Kontakte intensivieren, um eine größtmögliche internationale Unterstützung für die zentralen Prinzipien und Ziele der ukrainischen "Friedensformel" zu gewährleisten, heißt es in einer am Donnerstag beim EU-Gipfel in Brüssel verabschiedeten Erklärung der Staats- und Regierungschefs. Konkret wurde in diesem Zusammenhang auch der geplante Friedensgipfel genannt, der nach Vorstellungen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in der Schweiz organisiert werden könnte.
Bei ihm sollen sich nach den Vorstellungen der Regierung in Kiew möglichst viele Länder hinter die sogenannte "ukrainische Friedensformel" stellen. Zu ihr gehören der vollständige Abzug russischer Truppen vom ukrainischen Staatsgebiet, die Freilassung aller Kriegsgefangenen, ein Tribunal gegen russische Kriegsverbrecher sowie Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Einen Termin für den geplanten Gipfel gab es bis zuletzt nicht. Selenskyj hatte Anfang Juni gesagt, die Vorbereitungen dafür liefen. Weil man so viele Länder wie möglich dabei haben wolle, sei bislang aber noch kein Datum festgelegt worden.
Weitere Hilfe bietet die EU der Ukraine nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms an. Die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten seien bereit, zusätzlich zu der bereits laufenden Katastrophenschutzhilfe Unterstützung zu leisten, heißt es in einer am Donnerstag beim EU-Gipfel in Brüssel verabschiedeten Erklärung der Staats- und Regierungschefs. Die Staudamm-Zerstörung habe verheerende humanitäre, ökologische, landwirtschaftliche und wirtschaftliche Folgen und bedrohe auch die Sicherheit des Atomkraftwerks Saporischschja. Es ist das größte Europas.
Der Staudamm in der von russischen Truppen besetzten und unmittelbar an der Front gelegenen Stadt Nowa Kachowka war am 6. Juni gebrochen. Daraufhin strömten riesige Wassermassen aus dem angrenzenden Stausee aus. Viele Orte wurden überschwemmt. Die Ukraine, die sich seit 16 Monaten gegen den russischen Angriffskrieg verteidigt, ist überzeugt, dass Russland das Bauwerk absichtlich gesprengt hat. Auch viele internationale Experten halten das für wahrscheinlich. Moskau dementiert den Vorwurf. Selenskyj kritisierte indirekt, dass die EU Russland in der Gipfelerklärung nicht klar als Urheber für die Katastrophe nennt. Er warnte davor, dass das Ausbleiben einer starken EU-Reaktion auf die Staudamm-Zerstörung "russische Terroristen" zu Anschlägen auch auf das Atomkraftwerk Saporischschja verleiten könnte.
dp/fa