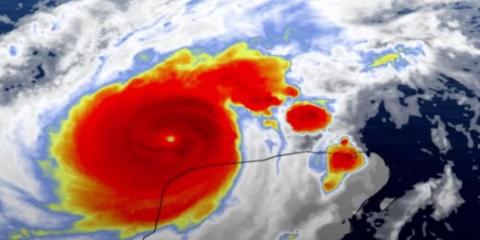"Der rechtskonservative Diskurs beginnt zunehmend, das gesamte politische Spektrum zu bestimmen und auch die Worte, mit denen man über das Thema spricht", sagt Isabella Löhr, Professorin für Internationale Geschichte des 20. Jahrhunderts an der Freien Universität Berlin. "Wir haben eine semantische Verschiebung Richtung Rechts im politischen Diskurs."
Eine Entwicklung, die Reem Alabali-Radovan, Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, kritisch sieht: "Eine Tonlage, die immer schärfer und populistischer wird sowie täglich neue Scheinlösungen präsentiert, spaltet unsere Gesellschaft in ‚Die anderen‘ und ‚Wir‘", sagt sie. "Es ist falsch, die Migrationsfrage als Ursache für sämtliche Probleme in unserem Land heranzuziehen, vom Gesundheitswesen bis in den Bildungsbereich. Gerade in diesen angespannten Zeiten muss die Sicherung des gesellschaftlichen Zusammenhalts oberste Priorität haben." Deutschland habe von seiner Einwanderungsgeschichte immer profitiert. "Die Bundesregierung steht zum Flüchtlingsschutz", so Alabali-Radovan. "Menschen mit Einwanderungsgeschichte, ihre Kinder und Enkel sind selbstverständlich Teil dieses Landes."
Auch der Präsident des PEN-Zentrums Deutschland, José F.A. Oliver, erkennt in der aktuellen politische Debatte wenig Konstruktives: "Diese Wortwahl ist unsäglich und im Grunde ihres Wesens ein Angriff auf die Würde der Menschen, die zur Flucht gezwungen werden. So schafft man keine Sensibilisierung in der Gesellschaft, sondern beschreibt die eigene politische Unfähigkeit, den Menschen eine Orientierung ins Zusammenleben zu geben", sagt er.
Aber woher rührt der rhetorische Wandel in der Politik? Ein Grund ist: Das Wählerpotenzial ist hoch. Drastische Forderungen in Sachen Migrationspolitik kommen bei vielen Menschen in Deutschland gut an. Das haben nicht zuletzt die hohen Zahlen der rechtsextremen AfD bei den Landtagswahlen in Hessen und Bayern gezeigt. "Der rechtskonservative Diskurs, der Migration und Flucht als zentrale Probleme unserer Gegenwart begreift, ist enorm erfolgreich", erklärt Löhr. "Dieses Wählerpotenzial wollen CDU/CSU und auch die FDP angesichts der nächsten Landtagswahlen für sich gewinnen. Deswegen verschärfen sie gerade den Diskurs."
Ein zweiter Grund: Der Nahostkonflikt und seine Auswirkungen auf Deutschlands Straßen. "Die antiisraelischen Proteste, insbesondere in Berlin-Neukölln, werden instrumentalisiert von CDU/CSU, um eine Verschärfung der Migrationspolitik durchzusetzen", sagt Löhr. Nach Einschätzung von Löhr zeigt sich die sprachliche Verschiebung besonders deutlich in einem Begriff, der sich aktuell als Schlagwort für Menschen, die nach Deutschland migriert sind, etabliert: "Illegale" oder "irreguläre" Migrantinnen und Migranten. "Wenn man nicht mehr von politisch Verfolgten, sondern vom Migrantinnen und Migranten spricht, wird der legitime Grund, in einem anderen Land Schutz zu suchen – was Grundlage des Völker- und Europarechts ist – unsichtbar gemacht", sagt Löhr.
Wer nur von Migrantinnen und Migranten spricht, erweckt also den Eindruck es gebe keine Menschen mehr, die wegen politischer Verfolgung flüchten. Dabei werden rund 50 Prozent der Asylanträge genehmigt – es gibt die politisch Verfolgten also weiterhin, sie verschwinden nur hinter dem Wort "Migrant". "Das Gebot, Verfolgten Schutz zu bieten, spielt in der politischen Sprache gerade keine Rolle", sagt Löhr. Durch das Adjektiv "irregulär" oder "illegal" werde die Migration zudem von vorneherein delegitimiert. "Die Forderung von Jens Spahn, physische Gewalt anzuwenden, ist der traurige Höhepunkt dieser Sichtweise."
Und Sprache bleibt nicht nur Sprache – besonders in politischen Fragen schafft sie Realitäten. "Mit einer Radikalisierung der Sprache geht auch eine Radikalisierung der inhaltlichen politischen Forderungen einher", sagt Löhr. "Die Verschiebung zu einer Terminologie, die stark von rechts dominiert wird, geht einher mit Wertungen, mit Vorstellungen davon, was legal oder nicht legal sein sollte – und mit Hierarchien zwischen Menschen und Vorstellungen darüber, wer mehr oder weniger Rechte bekommen sollte."
Wenn Bundesfinanzminister Christian Lindner und Marco Buschmann (beide FDP) also fordern, Sozialleistungen für Asylsuchende zu kürzen, um "Anreize" zu verringern, ist darin impliziert: Es gibt Menschen, die nur nach Deutschland migrieren, um vom Sozialstaat zu profitieren. Zugespitzt formuliert: Hier kommen keine Flüchtenden, sondern Sozialschmarotzer. Eine Vorstellung, die es bereits seit den 1980er-Jahren in Deutschland gibt.
Damals wurden diese Menschen "Wirtschaftsflüchtlinge" genannt und waren die Hassfigur der Asyldebatte. "Neben Asylsuchenden und Arbeitsmigranten waren Wirtschaftsflüchtlinge eine Art dritte Kategorie", sagt Löhr. "Gerade verschmilzt diese Kategorie mit dem Begriff ‚Migrant‘. Dadurch entsteht gesellschaftlich das Bild: Ein Migrant ist der, der zu Unrecht hier ist."
Vorstellungen wie diese befördern die Empathielosigkeit in der Migrationspolitik. Es wird konsequent ausgeblendet, was eine Flucht für Menschen bedeutet. Es ist egal, dass auch sogenannte "Wirtschaftsflüchtlinge" valide Gründe haben können, nach einem besseren Leben zu suchen – selbst wenn sie deswegen in Deutschland kein Asyl bekommen.
"Die Debatte hat sich auf gewisse Weise totalisiert. Man bekommt das Gefühl, es geht um Gegenstände, die man möglichst schnell wieder loswerden muss", kritisiert Isabella Löhr. Es werde weder nach Fluchtmotiven, Herkunftsländern, Altersgruppen, Qualifikationen noch nach völkerrechtlichen Verpflichtungen und Vorgaben differenziert. "Wir erleben eine enorme Pauschalisierung, die dazu führt, dass die betroffenen Menschen gar nicht mehr als solche wahrgenommen werden."