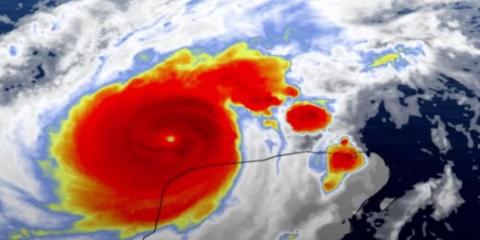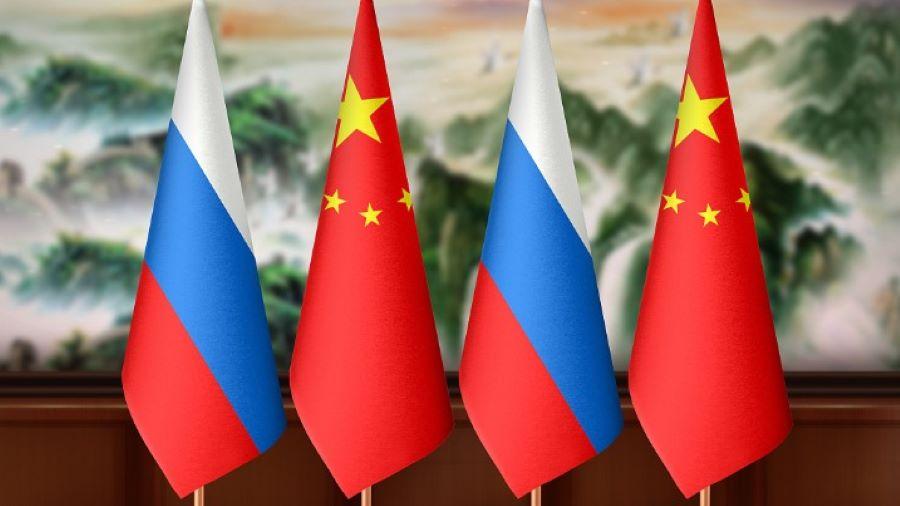
Die Freude über die sich zaghaft erholende Nachfrage aus dem Reich der Mitte dürfte allerdings regional ungleichmäßig ausfallen. Denn immer offener spiegelt die chinesische Volkswirtschaft die geopolitischen Machtverschiebungen wider, die die Weltgemeinschaft in zwei rivalisierende Einflusssphären teilt: Während Pekings Handel mit dem politischen Westen fast durchwegs schrumpft, füllen Teile des globalen Südens – und insbesondere Russland – das frei gewordene Vakuum.
Seit Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine und dem damit einhergehenden Exodus westlicher Firmen ist das russisch-chinesische Handelsvolumen praktisch durchgängig im zweistelligen Prozentbereich gestiegen. Unlängst hat Russland in der Rangordnung chinesischer Handelspartner auch Deutschland überholt. Die beiden Volkswirtschaften ergänzen sich geradezu komplementär. Während China Industriemaschinen und landwirtschaftliche Geräte nach Russland liefert, lässt es sich umgekehrt vom Kreml mit günstigen Energielieferungen versorgen. Rund 80 Prozent der chinesischen Importe entfallen laut den offiziellen Statistiken auf die Sparten Erdöl, Kohle und Elektrizität.
Des einen Freud ist dabei des anderen Leid: Nahezu mit derselben Rasanz, wie der Handel zwischen Peking und Moskau steigt, schrumpft gleichzeitig der wirtschaftliche Austausch mit Deutschland. In den letzten zwölf Monaten ist das bilaterale Warenvolumen um über 12 Prozent gesunken – ein deutlich stärkerer Rückgang, als etwa die Vereinigten Staaten (minus 7,2 Prozent) oder die Europäische Union (minus 6,4 Prozent) zu verzeichnen haben.
Zumindest in Teilen ist die Statistik jedoch irreführend. "Man muss bedenken, dass deutsche Unternehmen vermehrt vor Ort produzieren. Wenn also ein deutscher Hersteller in China eine Maschine baut und verkauft, wird diese nicht in der Importstatistik auftauchen", sagt Jens Hildebrandt von der deutschen Handelskammer in Peking. Der Wirtschaftsvertreter ist davon überzeugt, dass sich die Attraktivität deutscher Produkte an sich nicht verändert habe, sondern die Exporte vornehmlich unter der sich verlangsamenden chinesischen Wirtschaft leiden würden.
Doch es lässt sich kaum leugnen, dass die Entwicklung von Chinas Außenhandel auch politischer Natur ist. Die Polarisierung zwischen China und dem Westen führt sukzessive zu zwei unterschiedlichen Wirtschaftskreisläufen, die miteinander in Konkurrenz stehen. Dabei verstärken sich zwei parallel stattfindende Trends gegenseitig: Der Westen schneidet, unter Führung Washingtons, China in verstärktem Maße von Technologieexporten ab. Peking reagiert unter darauf anderem, indem es sich zunehmend am globalen Süden orientiert. So handelt China bereits seit letztem Herbst mehr mit Entwicklungsländern als den USA, der EU und Japan zusammen.
Die Divergenzen lassen sich auch an den Kapitalflüssen ablesen: China investiert mittlerweile vorwiegend in ressourcenreiche Staaten des Nahen Ostens und Südostasiens, während man sich aus den G7-Staaten zurückzieht. Umgekehrt haben die Investoren aus der EU und den USA ihre Aktivitäten auf dem chinesischen Markt derzeit fast vollständig auf Eis gelegt.
Die schiere Dimension der Kehrtwende wurde zuletzt am Freitag deutlich, als die nationale Devisenverwaltung ihre Daten veröffentlichte: Demnach sind Chinas sogenannte DirektInvestitionsverbindlichkeiten erstmals seit Beginn der Aufzeichnungen von vor 25 Jahren ins Minus abgerutscht. Das bedeutet im Klartext: Die Geldströme in Verbindung mit nicht chinesischen Unternehmen fließen mittlerweile in größerem Maße ins Ausland ab, als dass sie reinvestiert werden.
Die wirtschaftliche Polarisierung führt dabei auf beiden Seiten zu verschenkten Wachstumspotenzialen. Doch unter Staatschef Xi Jinping überwiegen längst andere nationale Interessen, allen voran sicherheitspolitischer Natur. Der langjährige China-Kenner und Ökonom Barry Naughton untersucht die verstärkten Steuerungsmechanismen, mit denen Xi die Wirtschaft zu lenken versucht. "Die Privatunternehmen fühlen eine starke Präsenz der Regierung, was sich negativ auf ihre Entscheidungsfindungen auswirkt", sagt Naughton, der an der University of California lehrt.
Zudem habe Xi nicht nur die bürokratischen Staatsunternehmen systematisch bevorzugt, sondern auch ihre Anreizstruktur verändert: Sie sollen mittlerweile weniger Profite bringen, sondern vorrangig den nationalen Interessen dienen. "Das ist fundamental anders im Vergleich zum China, das wir noch vor zehn Jahren kannten", sagt Naughton: "Dieses China ist mittlerweile längst verschwunden."