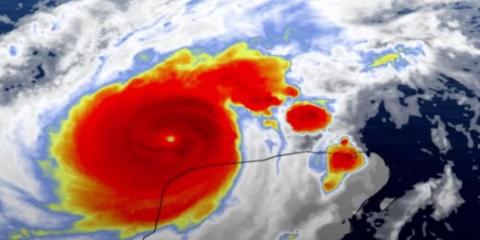Die sogenannte Einlagefazilität verharrt bei 4 Prozent. So viel bekommen die Kreditinstitute, wenn sie Bares bei der EZB parken. Die Notenbank teilte als Begründung mit: Die Inflation sei im September "merklich zurückgegangen". Die bisherigen Zinserhöhungen des EZB-Rats würden weiterhin stark auf die Finanzierungsbedingungen durchschlagen. "Dies dämpft zunehmend die Nachfrage und trägt so zu einem Rückgang der Inflation bei." Die Entscheidung entspricht den einhelligen Einschätzungen der Akteure an den Finanzmärkten.
Lagarde hatte die Zinspause bereits im September angedeutet. Gleichzeitig betonte sie pflichtgemäß auf der EZB-Pressekonferenz: "Wir sind entschlossen, dafür zu sorgen, dass sich die Inflation 2 Prozent annähern wird." Das ist die wichtigste Aufgabe ihrer Behörde.
Clemens Fuest, Präsident des Münchner Ifo-Instituts, sprach von einer guten Entscheidung: Die schnellen Zinserhöhungen hätten die Inflation gedämpft und Inflationserwartungen stabilisiert. "Diese Entwicklung wird sich voraussichtlich in den kommenden Monaten fortsetzen." Auch Friedrich Heinemann vom Mannheimer Forschungsinstitut ZEW betonte: "Zinserhöhungen wirken wie ein Langzeitmedikament mit erheblichen Zeitverzögerungen. Es wäre daher falsch, jetzt noch die Dosis weiter zu erhöhen, obwohl die ersten Symptome auf eine allmähliche Genesung hindeuten."
Die EZB hatte viel Vertrauen verspielt, als sie den massiven Anstieg der Inflation in der Euro-Zone zunächst ignorierte, ihn dann als vorübergehend abtat. Erst im Sommer 2022 wurde die erste Erhöhung der Leitzinsen beschlossen. Das war das Ende einer jahrelangen ultralockeren Geldpolitik, die unter anderem einen Dauerboom in der Immobilienbranche und an den Aktienmärkten ausgelöst hatte.
Dem ersten Schubs nach oben folgten kurz hintereinander neun weitere, eine bislang einmalige Kaskade in der Geschichte der europäischen Notenbank. Es gibt aktuell zahlreiche Gründe dafür, dass schon im Vorfeld viele Volkswirte und Bankanalysten auf die Zinspause gesetzt hatten.
Zuallererst: Die Inflation im Währungsgebiet ist in den vergangenen Monaten deutlich auf zuletzt 4,3 Prozent nach unten gegangen. In Deutschland waren es für September im Vergleich zum Vorjahr noch 4,5 Prozent. Aber vieles deutet darauf hin, dass es weiter nach unten geht. So haben sich die Importpreise spürbar verbilligt, die zuvor insbesondere bei Nahrungsmitteln für massive Schübe gesorgt hatten.
Noch wichtiger ist, dass die sogenannte Kerninflation im Euro-Raum ebenfalls spürbar zurückgeht. Sie lag zuletzt bei 4,5 Prozent. Bei dieser Kennziffer werden Nahrungsmittel und Energie, die in der Regel stark schwanken, ausgeklammert. Deshalb taugt die Kerninflation als wichtiger Indikator für den mittelfristigen Trend bei der Teuerung.
Dass es derzeit in die richtige Richtung geht, zeigen auch die Erzeugerpreise, die heftig nachgeben. Hierbei handelt es sich um die Preise, die gezahlt werden, wenn Unternehmen Geschäfte untereinander machen. Sowohl Energie als auch Vorprodukte sind günstiger zu haben – was sich mit Verzögerung auch darauf auswirkt, wie viel Verbraucher im Supermarkt oder für Strom und Gas zahlen müssen.
Als weiterer Punkt, den Lagarde als Begründung für eine Zinspause anführte: die Geschäfte der europäischen Banken. Die Kreditvergabe an Privatleute und Unternehmen ist deutlich geschrumpft – wegen enormer Risiken bei einer Neuverschuldung aufgrund des hohen Zinsniveaus. Dennoch haben viele Banken die Standards für die Vergabe von Darlehen sogar noch einmal angezogen – aus Angst vor Zahlungsausfällen wegen der wackeligen Konjunktur. Dies geht aus einer Befragung der EZB hervor, deren Ergebnisse Finanzmarktexperten als deutliches Signal für rezessive Tendenzen in den europäischen Volkswirtschaften bewerten.
Hinzu kommt, dass bei den Staatsanleihen der Euro-Länder die Renditen wieder stärker auseinandergehen. So ist der Abstand zwischen deutschen und italienischen Papieren mit zehnjähriger Laufzeit auf fast 2 Prozent gestiegen, im Juni waren es noch 1,5 Prozent gewesen. Noch höhere Leitzinsen würden diese Entwicklung mutmaßlich noch verstärken. Und so etwas sieht die Finanzwelt gar nicht gern, weil es bedeutet, dass insbesondere Staaten im Süden der Währungsunion in die Bredouille geraten können, was heftige wirtschaftliche Verwerfungen in ganz Europa nach sich ziehen könnte.
Michael Heise vom HQ-Trust betont denn auch: Die EZB sollte jetzt die bisherigen Zinssteigerungen zunächst einmal "durchwirken lassen". Dadurch würden die Chancen "einer einigermaßen sanften Landung der Euro-Wirtschaft" gewahrt.
Der EZB-Rat ließ aber auch durchblicken, dass das hohe Zinsniveau noch einige Zeit gehalten werden soll: "Es wird nach wie vor erwartet, dass die Inflation zu lange zu hoch sein wird, und der binnenwirtschaftliche Preisdruck bleibt hoch." Fuest machte ebenfalls deutlich: "Für Zinssenkungen ist es allerdings noch zu früh." Auch Heinemann zeigt sich skeptisch: Ob es mit der Genesung so glatt weitergehe, sei unsicher. "Eskaliert der Nahostkrieg, könnte der nächste inflationäre Angebotsschock vor der Tür stehen."