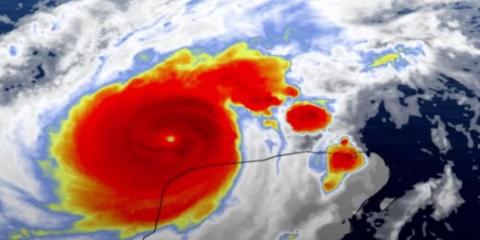Normalerweise ist Nogales ein quirliger Grenzort im äußersten Süden des US-Bundesstaats Arizona. Ein mächtiger rostbrauner Stahlzaun mit viel Stacheldraht und zwei Zollstationen trennen die 20.000-Einwohner-Gemeinde von ihrer zehnmal so großen gleichnamigen Schwesterstadt in Mexiko. Zehntausende pendeln gewöhnlich täglich von der einen auf die andere Seite – Arbeiterinnen und Arbeiter, Schulkinder, Familienangehörige. Aber auch Amerikaner, die abends echte Fajitas essen und Mexikaner, die US-Produkte erwerben wollen.
Doch seit vor wenigen Wochen aus Personalmangel kurzerhand vier der acht Fahrspuren am Grenzübergang geschlossen wurden und sich nun zweistündige Schlangen vor den Abfertigungsstellen bilden, ist der Freizeitverkehr weitgehend weggebrochen. Dafür kommen jetzt täglich neun oder zehn Busse mit Migrantinnen und Migranten, die von den Beamten der Customs and Border Protection (CBP) aufgegriffen wurden und in der Stadt abgesetzt werden, bis sie irgendwann von der Bezirksverwaltung weiter gen Norden transportiert werden.
"Niemand hat uns vorher informiert", beschwert sich Bürgermeister Jorge Maldonado. Den kräftigen Sohn mexikanischer Einwanderer, der in Arizona aufwuchs, aber auf der anderen Seite der Grenze nebenbei die Rinderfarm seiner Familie betreut, kann eigentlich nichts so leicht aus der Ruhe bringen. Aber gerade ist er auf "die in Washington" richtig sauer.
Das Nadelöhr am Grenzübergang schadet dem heimischen Handel gewaltig. Zudem werden die Nächte kälter: Es droht eine humanitäre Notlage für die Migranten auf den Straßen. Mittel für die Betreuung der Geflüchteten hat er nicht. "Die sollten sich die Lage vor Ort mal anschauen, bevor sie solche Entscheidungen treffen", wettert der demokratische Politiker über seine Parteifreunde in der 3700 Kilometer entfernten Bundeshauptstadt.
Wie der Bürgermeister hadern viele Amerikaner mit der Biden-Regierung. Die Zustimmungsraten des Präsidenten sind dauerhaft unter 40 Prozent gefallen. Selbst jeder vierte Demokrat zeigt sich bei Umfragen inzwischen unzufrieden. Besonders ernst ist die Lage in den parteipolitisch nicht klar verordneten Swing States, die für eine Wiederwahl von Biden aber unverzichtbar sind: Staaten wie Arizona, wo der Präsident 2020 gerade mal 10.000 Stimmen mehr als Donald Trump holte. Mit 34 Prozent stellen die Wechselwähler hier im Südwesten der USA die größte Wählergruppe. Wie unter einem Brennglas werden in dem Wüstenstaat mit seinen Boom-Metropolen Phoenix und Tucson die Probleme von Joe Biden sichtbar.
"Elf Monate sind eine Ewigkeit in der Politik", schränkt Doug Cole gleich zu Beginn des Gesprächs ein. Cole ist ein alter Hase in Sachen Politikberatung. Er hat das Geschäft seinerzeit als Mitarbeiter des legendären Republikaners John McCain gelernt und arbeitet nun bei der PR-Agentur Highground in der Landeshauptstadt Phoenix. "Aber so, wie es im Moment aussieht, bekommen wir ‚rinse and repeat‘ (ausspülen und wiederholen)", scherzt er in Anspielung auf die Gebrauchsanweisung vieler Shampoos – und meint: eine Wiederholung des Duells Biden gegen Trump im November 2024. "Und im Augenblick sehe ich hier in Arizona Trump vorn."
Cole ist ein moderater Republikaner, der Trump wegen seiner Lügen verabscheut. Bei der letzten Wahl vor drei Jahren hat er für Biden gestimmt. Nach seiner Einschätzung hat der Präsident jetzt aber mit einer Reihe von Handicaps zu kämpfen. Da ist zunächst sein Alter: "Er schlurft beim Gehen und verhaspelt sich beim Ablesen vom Teleprompter." Das schade Biden vor allem bei jüngeren Wählern. Dann die Inflation: "Jeder hat inzwischen festgestellt, dass die halbe Gallone (1,9 Liter) Milch jetzt nicht mehr 2,25 Dollar, sondern 3 Dollar kostet." Dafür könne Biden zwar wenig, "aber als Präsident wird er dafür verantwortlich gemacht", zumal er gleichzeitig seine ökonomischen Erfolge sehr schlecht verkaufe.
Und schließlich, natürlich, ist da die Situation an der Grenze, die gerade bundesweit für Schlagzeilen sorgt und beim rechten TV-Sender Fox News Dauerthema ist. "Beide Parteien sind für den Schlamassel verantwortlich, beide haben es verpasst, die Einwanderungsgesetze zu reformieren", sagt Cole. Nun aber sitzt halt Biden im Weißen Haus, der das heikle Thema am liebsten ignoriert hätte. Doch das geht nicht. Gut 2,4 Millionen Migranten sind im Ende September abgelaufenen Haushaltsjahr ins Land gekommen – ein Rekordwert. Und der Druck wächst weiter. Aktuell ist die Lage an dem 400 Kilometer langen Teilabschnitt der Grenze südlich von Tucson besonders dramatisch. Allein in der ersten Dezemberwoche wurden hier 17.500 Menschen ohne Papiere aufgegriffen.
Ziemlich kopflos hat die Biden-Regierung jetzt eilig überall in der Region Zollbeamte abgezogen, um den Zustrom dort, wo es keinen Zaun gibt, zumindest halbwegs zu kontrollieren. Weil dort nun das Personal fehlt, wurde der legale Grenzübergang in Nogales halb und der in Lukeville weiter im Westen komplett dichtgemacht. Das aber, glaubt Cole, sei eine richtig schlechte Idee. Über Lukeville nämlich führt die Straße nach Puerto Penasco, einer Art mexikanischem Rimini am Golf von Kalifornien. Viele Menschen aus dem Südwesten der USA machen normalerweise in dem Küstenort anderthalb Autostunden hinter der Grenze Urlaub, verbringen dort Weihnachten oder besitzen gar eine Ferienwohnung. "Lukeville zu schließen ist so ähnlich, als wenn man die Grenze zwischen Schleswig-Holstein und Dänemark dichtmachen würde", empört sich Cole. "Wenn Biden Arizona gewinnen will, ist das sicher nicht der richtige Weg."
Auch Bürgermeister Maldonado ist frustriert über die Grenzpolitik der Biden-Regierung. Seiner Meinung nach muss dringend eine Regelung wieder eingeführt werden, die eine Zurückweisung von Asylsuchenden bis zum Entscheid über ihren Antrag ermöglicht. Längst käme das Gros der Hilfesuchenden nicht mehr aus Lateinamerika, berichtet Maldonado: "Darunter sind Afrikaner und Asiaten, die kommen aus der ganzen Welt." Doch das wolle in Washington keiner hören. Dort schränke man eher die Bewegungsfreiheit der legalen Pendler ein, als etwas gegen die illegalen Einwanderer zu tun.
Das sind harte Worte. Doch der demokratische Lokalpolitiker fühlt sich alleingelassen mit seinen Problemen vor Ort. Während des Gesprächs greift er zum Handy, auf dem er die Webcam-App vom Grenzübergang eingerichtet hat: "Jetzt sind es schon wieder zwei Stunden Stau." Neulich hat Maldonado bei einer Kundgebung der republikanischen Senatskandidatin Kari Lake gesprochen, die an der Grenze um Stimmen wirbt. Zur Wahl der rechtspopulistischen Trump-Apologetin aufrufen will er zwar ausdrücklich nicht. Aber er fremdelt sichtlich mit seiner Partei: "Wenn Biden das Beste ist, was die Demokraten 2024 aufbieten können, dann haben sie ein Problem."
Zweieinhalb Autostunden nördlich, in der Universitätsstadt Tempe am Rande von Phoenix, ist Hazim Nasaredden schon einen Schritt weiter. "Dreimal habe ich seit 2012 Demokraten gewählt, weil sie das kleinere Übel waren", sagt der 41-jährige Apotheker. Damit sei es nun vorbei: "Im nächsten Jahr stimme ich nicht mehr für Biden."
Der in Kalifornien geborene Sohn eines Palästinensers und seine Frau Amal Fayad, die als Diplom-Psychologin arbeitet, gehören zur Minderheit der arabischstämmigen Amerikaner. Mit rund einem Prozent der Gesamtbevölkerung fällt diese Gruppe zahlenmäßig kaum ins Gewicht. Politisch aber gewinnt sie gerade gewaltig an Bedeutung. Die überwiegende Mehrheit der Muslime hat zuletzt nämlich für Biden gestimmt. Doch der Gazakrieg hat alles verändert. Viele Arab Americans sind erbost über ihren Präsidenten: Sie werfen ihm mangelndes Eintreten für die humanitären Belange der Palästinenser oder gar eine Beihilfe zum "Völkermord" an ihren Familien vor. In Umfragen sind Bidens Zustimmungswerte in dieser Gruppe auf 17 Prozent abgesackt. Damit ist in Swing States wie Michigan oder auch Arizona, wo mehr als 100.000 Menschen mit arabischen Wurzeln leben, Bidens hauchdünne Mehrheit ernsthaft bedroht.
Das Ehepaar Nasaredden/Fayad, das gemeinsam zum Gespräch in ein arabisches Lokal gekommen ist, lebt seit Jahrzehnten in Arizona, seine drei Kinder wurden hier geboren und sind amerikanische Staatsbürger. "Bei uns zu Hause gibt es Burger, Pizza und Chickenwings", berichtet die 39-jährige Fayad. Aber von der israelfreundlichen Biden-Regierung fühlen sie sich ausgegrenzt. "Wir haben Biden wochenlang ermahnt, einen Waffenstillstand zu fordern. Er hat es nicht getan", sagt Nasaredden, dessen Vater in der Westbank lebt. Die Regierung, moniert Fayad, sei nicht einmal bereit, Empathie für das Leid der Palästinenser zu zeigen: "Wenn ein Israeli umkommt, wird er nach deren Lesart ‚getötet‘. Palästinenser ‚sterben‘ einfach."

Firmengründung und Registrierung einer US Inc oder AG
Die vergangenen Wochen, sagen beide, hätten sie stark politisiert. "Zum ersten Mal kam der Gedanke auf: Wir müssen nicht für eine der beiden Parteien stimmen", berichtet Fayad. Ihre Sympathien gelten dem ultralinken Kandidaten Cornel West. Chancen auf einen Einzug ins Weiße Haus hat der zwar nicht, aber so wollen sie und ihr Mann den Demokraten einen Denkzettel verpassen.
In der Konsequenz freilich würde die Zersplitterung der nicht republikanischen Stimmen mutmaßlich Donald Trump den Weg ins Weiße Haus ebnen. Eine Weile versucht sich Nasaredden dieser brutalen Logik des amerikanischen Zweiparteiensystems argumentativ zu entziehen. Dann räumt er ein: "Ja, die Gefahr besteht." Aber der Gedanke schreckt ihn offenbar nicht. Er arbeitet aktiv in einer Kampagne mit dem Schlachtruf "Abandon Biden" (löst Biden ab) mit. "Vier Jahre unter Trump können nicht schlimmer sein als eine Nacht unter dem israelischen Bombardement", lautet seine harte Begründung.