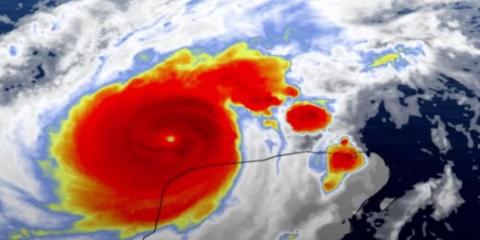Österreich beherbergt mehrere UN-Organisationen und internationale Organisationen wie die OSZE, die während des Kalten Krieges als Forum für den Dialog zwischen Ost und West gegründet wurde. Russland ist eine der 57 Nationen in Nordamerika, Europa und Asien, die sich an der Organisation mit Sitz in Wien beteiligen. Moskau plant, Delegierte zum Treffen der Parlamentarischen Versammlung der OSZE vom 23. bis 24. Februar zu entsenden, darunter 15 russische Abgeordnete, die Sanktionen der Europäischen Union unterliegen. Unter ihnen sind der stellvertretende Duma-Vorsitzende Pjotr Tolstoi und sein Parlamentskollege Leonid Slutsky.
81 OSZE-Delegierte aus 20 Ländern, darunter Frankreich, Kanada, Großbritannien, Polen und die Ukraine, forderten in einem Brief an Österreichs Bundeskanzler, Außenminister und andere Beamte der österreichische Regierung auf, die Teilnahme der sanktionierten Russen zu verbieten. "Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass russische Parlamentarier ein integraler Bestandteil des Machtsystems und an den Verbrechen beteiligt sind, die Russland jeden Tag in der Ukraine begeht", heißt es in dem Brief. "Sie haben keinen Platz in einer Institution, deren Aufgabe es ist, einen aufrichtigen Dialog und Widerstand gegen den Krieg zu fördern."
Die US-Delegierten der Parlamentarischen Versammlung gehörten nicht zu den Unterzeichnern des Schreibens. Der US-Botschafter bei der OSZE, Michael Carpenter, sagte Reportern am Freitag, dass die russischen Delegierten "keine Menschen sind, die es verdienen, in westliche Länder reisen zu können". Carpenter fügte jedoch hinzu, dass es "an der österreichischen Regierung liegt, zu entscheiden, ob sie Visa erteilt oder nicht". Österreichische Beamte haben den Brief nicht kommentiert. Am 5. Februar verteidigte Außenminister Alexander Schallenberg die Entscheidung Österreichs, die sanktionierten Russen ins Land zu lassen, und argumentierte, es sei wichtig, trotz des "brutalen russischen Angriffs auf die Ukraine" die Kommunikationskanäle mit Moskau offen zu halten. Das österreichische Außenministerium betonte zudem, dass es als Gastgeber des OSZE-Hauptquartiers in Wien gesetzlich verpflichtet sei, Vertretern der teilnehmenden Nationen, die dort an Treffen teilnehmen wollen, Visa zu erteilen.
Österreich, das 1995 Mitglied der Europäischen Union wurde, hat Moskau kritisiert und sich den Sanktionen angeschlossen, die die EU wegen der Invasion der Ukraine gegen Russland verhängt hat. Aber im Gegensatz zu Finnland und Schweden, die im Mai beschlossen, ihre neutrale Haltung aufzugeben, indem sie einen Beitrittsantrag zur NATO stellten, hält Österreich an seiner 1955 angenommenen militärischen Neutralität fest. Die österreichische Regierung hat humanitäre Hilfe in die Ukraine geschickt, aber keine Waffen. Bundeskanzler Karl Nehammer war der erste und bisher einzige EU-Staatschef, der den russischen Präsidenten Wladimir Putin nach Kriegsbeginn persönlich traf. Nehammer reiste im April 2022 nach Moskau in einem vergeblichen Versuch, den russischen Kreml-Chef davon zu überzeugen, die Invasion zu beenden. Die Unterstützung der österreichischen Neutralität in der Öffentlichkeit und im politischen Establishment ist nach wie vor groß.
"Ich glaube, dass die österreichische Neutralität auch heute noch eine positive Rolle spielen kann", sagt Ralph Janik, Völkerrechtler und Forscher an der Sigmund Freud Privatuniversität in Wien. "Die Alternative wäre ein NATO-Beitritt, aber jeder einzelne österreichische Politiker ist sich sehr wohl bewusst, dass dies von der Mehrheit der österreichischen Öffentlichkeit nicht unterstützt wird." Österreich, das im Vorfeld des Zweiten Weltkriegs von Nazideutschland annektiert wurde, erklärte nach dem Krieg auf Druck der westlichen Alliierten und der Sowjetunion seine Neutralität. Sie suchte eine Vermittlerrolle zwischen Ost und West und baute während und nach dem Kalten Krieg Beziehungen zu Moskau auf.
1968 importierte Österreich als erstes westeuropäisches Land Gas aus der Sowjetunion, und seine Abhängigkeit von russischer Energie nahm in den folgenden Jahrzehnten zu. Vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine stammten 80 % des österreichischen Erdgases aus Russland. Seitdem hat es den Anteil auf knapp über 20 % reduziert, indem es sich nach Angaben der österreichischen Regulierungsbehörde für Strom und Gas an norwegisches Gas wandte. Auch das österreichische Bankensystem ist eng mit Russland verbunden. Österreichs zweitgrößte Bank, die Raiffeisenbank International, erwirtschaftete 2022 mehr als die Hälfte ihrer Gewinne in Russland. Die Bank steht unter starkem Druck, ihr Geschäft in Russland trotz Moskaus Krieg gegen die Ukraine fortzusetzen, und prüft derzeit strategische Optionen, einschließlich eines Ausstiegs aus Russland.
Wien ist aufgrund seiner milden Spionagegesetze auch als Tummelplatz für Spione, auch aus Russland, bekannt. Trotz anfänglicher Zurückhaltung hat Österreich acht russische Diplomaten ausgewiesen, die seit Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine angeblich in Spionagetätigkeiten verwickelt waren. Während es keine Anzeichen für eine Abkehr von der österreichischen Neutralität gibt, haben einige eine Neubewertung der Politik nach dem Ukraine-Krieg gefordert.
Werner Fasslabend, ehemaliger österreichischer Verteidigungsminister von der Konservativen Volkspartei, gehört zu den wenigen prominenten Stimmen, die für einen Verzicht auf die Neutralität und einen NATO-Beitritt plädieren. Mit dem Ende des Kalten Krieges und dem EU-Beitritt Österreichs habe die österreichische Neutralität "ihre Funktion verloren", sagte Fasslabend, der Direktor des Österreichischen Instituts für Europa- und Sicherheitspolitik. Als Nato-Mitglied könne Österreich "die europäische Sicherheitspolitik besser mitgestalten und erhalte mehr Sicherheit", fügte er hinzu und räumte ein, dass dies aufgrund einer Verfassungsänderung mit Zweidrittelmehrheit im Bundesrat unwahrscheinlich sei Österreichisches Parlament. "Diese Mehrheit ist nicht in Sicht", sagte Fasslabend.
dp/pcl