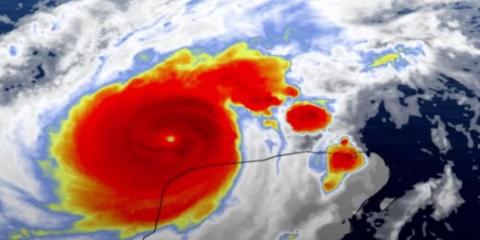Nach den Sondierungen der vergangenen Wochen will der wiedergewählte CDU-Ministerpräsident Boris Rhein die Koalitionsgespräche, womöglich schon in der kommenden Woche, nicht mehr mit der Ökopartei führen, sondern mit der SPD. Nach zehn Jahren, die bundesweit als erfolgreiche und stabile Regierungszeit gewertet wurden, sodass das wirtschaftsstarke Flächenland im Herzen der Republik immer als Vorbild für das Modell Schwarz-Grün gegolten hatte.
Vorbei, vorbei. "Wir wollen als CDU den Versuch unternehmen, in Hessen eine Regierung mit der SPD zu bilden und zum ersten Mal seit 70 Jahren in einer christlich-sozialen Koalition zusammenarbeiten", erklärte Rhein im schmucklosen Medienraum des Wiesbadener Landtages. Die Entscheidung sei in Präsidium, Landesvorstand und Fraktion seiner Partei einstimmig gefallen. Ziel sei nun, mit der SPD ein Regierungsprogramm zu schreiben, das Vernunft und Fortschritt verbinde: "Ein Programm für Vernunft im Umgang mit der Migration. Besonnen, nie mit Schaum vorm Mund. Aber doch mit sehr klaren Entscheidungen und mit auch sehr klaren Weichenstellungen", sagte der Wahlgewinner – und deutete nicht nur damit an, warum die CDU sich für den kleineren, roten Koalitionspartner und gegen den altbewährten, grünen entschieden hat.
Die für den Zuschlag entscheidenden Stichworte, die Rhein nennt, lassen sich als Zusammenfassung dessen lesen, was man den Grünen im konservativen Parteien- und Wählerspektrum derzeit bundesweit vorwirft – auch innerhalb der Ampel-Regierung, wo vor allem Koalitionspartner FDP mit ihnen hadert und streitet. In Hessen habe sich Schwarz-Rot beim Thema Migration zum Beispiel bereits in den Sondierungsgesprächen auf eine Bundesratsinitiative zur Ausweitung der sicheren Herkunftsländer geeinigt, in die sich leichter abschieben lässt.
Fortschritt dagegen wolle man erreichen durch "Anreize statt Verbote": "Die Menschen wollen nicht bevormundet werden", sagt Rhein. "Sie sind bereit zur Veränderung", aber eben nicht durch Bevormundung, sondern durch Beteiligung. "Sie wollen entlastet werden und nicht belastet." Laut den Eckpunkten für die Koalitionsverhandlung will Schwarz-Rot nun Politik für Kita-Ausbau, für Autofahrer und -industrie und "gegen neue Anreize für irreguläre Migration" und gegen Gendersprache.
Das liegt genau auf der Linie des Bundesvorsitzenden der CDU, Friedrich Merz, der die Grünen längst zum politischen Hauptgegner ausgerufen hat – und dem die stabilen Zweierkoalitionen der CDU mit den Grünen in Düsseldorf, Stuttgart, Kiel und eben Wiesbaden nie ins konservative Profil gepasst haben. Zwar betont Boris Rhein am Freitag, dass Merz "keinerlei Einfluss auf die Entscheidung genommen" habe. Zugleich ist es kein Geheimnis, dass die Bundespartei ihrem Landesverband durchaus die taktischen Vorteile geschildert hat, wenn die Union in den Ländern in möglichst vielen Farbvarianten regiere, man also den Trend zu Schwarz-Grün auch mal breche. Nicht alle in der Hessen-CDU fanden das klug. Zumal, wie Rhein einräumt, die Grünen sehr weit auf die CDU zugegangen waren. Leider halt nicht bei den Themen, auf die die CDU gerade besonders setzt, hört man hinter vorgehaltener Hand.
Angesichts des großen Abstands, mit dem die Union im Bund die Umfragen anführt, löst die Entscheidung der Rhein‘schen Union deshalb bei der Ampel in Berlin einige düstere Zukunftsvisionen für die Zeit nach der nächsten Bundestagswahl aus – bei der Kanzlerpartei, die sich in Hessen als Juniorpartner anbiedern muss; bei der FDP, die dort zu klein ist, um überhaupt noch eine Rolle zu spielen; bei den Grünen, die selbst dort von der Union verschmäht werden, wo sie – anders als in Berlin, wo sie zuletzt aus der Regierung geflogen waren – besonders pflegeleicht sind.
Für die Grünen ist Rheins Rauswurf deshalb ein Alarmzeichen. Noch nach der Bundestagswahl 2021 hatte es geheißen: Jamaika oder Ampel – aber nichts geht ohne Grüne, und noch bis zum Sommer vorigen Jahres erlebten sie einen Umfrage-Höhenflug und stellten mit Vizekanzler Habeck und Außenministerin Baerbock die beliebtesten Bundespolitiker. Heute gelten sie vielen als das Gesicht der Problem-Ampel – und das, obwohl ihre Umfragewerte auf dem Niveau des Wahlergebnisses liegen, während die SPD rund 10 Prozentpunkte eingebüßt und die FDP sich halbiert hat. Doch was hilft das ohne Anschlussfähigkeit und wenn selbst die eben noch verhasste Große Koalition schon wieder ihren Schrecken verliert?
Auch in Hessen hatten sich nach der Wahl deutlich mehr demoskopisch Befragte Schwarz-Rot als Schwarz-Grün gewünscht. Für eine Ampel im Wiesbadener Landtag hätte es wegen des deutlichen Wahlsiegs der CDU, der Faeser als zweitstärkster Kraft und einer grandios gescheiterten SPD unter Bundesinnenministerin Nancy Faeser als Spitzenkandidatin gar nicht erst gereicht.
Und doch ist es nun der Grüne Tarek Al-Wazir, der als langjähriger Vize-Ministerpräsident eigentlich selbst den Chefsessel erklimmen wollte und seine Partei stattdessen nun wieder dorthin führen muss, wo sie bis 2014 waren: in die Opposition. Für Al-Wazir, der sich mit Rheins Vorgänger Volker Bouffier besser verstand, ist das auch deshalb eine bittere Pille, weil das Klischee des rebellischen Grünen auf ihn nicht passt.
Im Gegenteil: Er gehört im Lager der Realos seit langem zu den Oberrealos und hat selbst dann noch stillgehalten, als die Partei bereits zu murren anfing – etwa beim Weiterbau der Autobahn 49 durch den Dannenröder Forst, der zögerlichen Aufklärung des Skandals um den Nationalsozialistischen Untergrund, in den ein hessischer Verfassungsschützer verwickelt war, oder Rechtextremismus-Skandale bei der Landespolizei. Im Wahlkampf betonte Al-Wazir mit Blick auf die Zerwürfnisse der Berliner Ampelkoalition gern, dass Kompromissbereitschaft weiter führe. Nach Rheins Entscheidung stimmt das nun so nicht mehr.
Der aus Hessen stammende Co-Parteichef Omid Nouripour macht aus seiner Enttäuschung denn auch kein Hehl. "Die Entscheidung der hessischen CDU, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Grünen aufzugeben, ist für mich nicht nachvollziehbar", sagte er. "Die vergangenen zehn Jahre waren geprägt von stabiler und vertrauensvoller Regierungsarbeit in turbulenten Zeiten. Es gab auch keine Wechselstimmung in Hessen. Offensichtlich regiert Boris Rhein lieber mit einer geschwächten SPD."
Gut möglich, dass die Partei auf der Bundesebene das gleiche Schicksal ereilt wie die Freunde in Wiesbaden: Sie üben sich in Anpassung – und müssen nach der nächsten Wahl trotzdem das Kabinett verlassen. Es wäre das vorläufige Ende eines lang ersehnten Aufstiegs.
Die SPD hatte den Frustpunkt bereits im Oktober erreicht: Nicht zuletzt für die Sozialdemokraten im Bund war die verlorene Hessen-Wahl ein weiterer schwerer Rückschlag in einer Serie von Enttäuschungen, die nach Bildung der Ampel eingesetzt hatte. Vom "sozialdemokratischen Jahrzehnt", das die Parteispitze berauscht ausgerufen hatte, nachdem Olaf Scholz überraschend Kanzler geworden war, spricht niemand mehr.
Die Regierungsbeteiligung, die Nancy Faeser nun in Wiesbaden herausgeholt hat – wenn auch nur als Mini-Juniorpartner mit 15 Prozent der Stimmen – hebt die Stimmung im Willy-Brandt-Haus wieder. Auch wenn sich manch eine Sozialdemokratin schon Hoffnung gemacht hatte, Faeser im Amt der Bundesinnenministerin zu beerben, bleibt die Hessin – allen Spekulationen zum Trotz – in Berlin. Am Freitagmittag trat sie vor die Kameras und verkündete das endgültig. Als beschädigt wird sie in der Bundes-SPD nicht gehandelt, im Gegenteil: Sie gilt in der Partei als nerven- und durchsetzungsstark und sehr menschlich. Im Ministerium habe sie es da schwerer, heißt es.
Man erinnert sich, wie einst CDU-Chefin und Kanzlerin Angela Merkel mit Norbert Röttgen umgegangen war, als der die Wahl in NRW verloren hatte und Bundesumweltminister bleiben wollte. Sie setzte ihn vor die Tür. Aber das Verhältnis von Merkel zu Röttgen ist nicht mit dem von Scholz und Faeser zu vergleichen. Merkel ist mit Scholz nicht zu vergleichen. Wie lange dieser an Christine Lambrecht als Verteidigungsministerin festgehalten hatte, obwohl sie sehr schnell für die Bundeswehr als untragbar galt, sagt alles. Und mit Faeser als Innenministerin kann er sehr viel zufriedener sein.
Schwarz-Grün in Hessen galt vor zehn Jahren als Test in einem Flächenland, ob eine solche Koalition im Bund funktionieren könnte. Große Koalitionen sind zwar nichts Neues, aber für Boris Rhein gibt es andere, schwerer wiegende Argumente dafür. "Es ist richtig und wichtig, dass sich die beiden Volksparteien CDU und SPD, wenn die Situation wegen der vielen Krisen herausfordernd ist und draußen der Wind besonders hart weht, die Hand reichen und zusammenarbeiten können", sagte er am Freitag.
Eine Volkspartei zeichne sich nicht durch ihre Größe aus, sondern durch ihre tiefe Verwurzelung in der Gesellschaft insbesondere in den Kommunen, findet er. "Ich habe immer gesagt: Demokraten müssen untereinander anschlussfähig sein – das zeigen die ältesten Parteien des Landes mit ihrer Entscheidung, gemeinsam in Hessen koalieren zu wollen", so Rhein. "Unsere christlich-soziale Koalition steht für Vernunft etwa im Umgang mit Migration und für Fortschritt bei Wirtschaft, Innovation und Klimaschutz. Die Bekämpfung der aktuellen Krisen braucht eine Renaissance der Realpolitik mit echten Problemlösungen statt abstrakter Phantomdebatten."
Was Rhein nicht erwähnt: Die AfD ist in Hessen zweitstärkste Kraft geworden. Keiner weiß, was im Bund 2025 passiert und wie viel Kraft aufgewendet werden muss, um aus der Mitte heraus weiterzuregieren. Auch wenn im Bund niemand mehr eine Groko wollte: Union und SPD, so wird es auch hinter den Kulissen erzählt, erscheint sie in diesen Zeiten nicht als schlechteste Option.