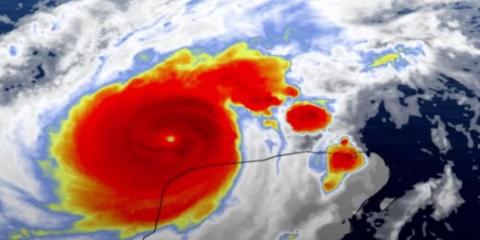Die Risiken, die von den Führungskräften der Credit Suisse eingegangen wurden, waren anderer Natur, aber immer noch beträchtlich. Durch die Beteiligung an Unternehmen wie den inzwischen aufgelösten Greensill und Archegos wurde das Kapital der Bank in Mitleidenschaft gezogen. Die Bußgelder, die nach einem Skandal nach dem anderen aufgelaufen sind, haben sich auch in ihr Kapital gebissen. Man kann sagen, dass es den Beteiligten auch an Gefühl im Spiel gefehlt hat.
Nach der Finanzkrise von 2008 gab es auf beiden Seiten des Atlantiks Anstrengungen, um sicherzustellen, dass künftige Rettungsaktionen für Einleger so wenig Steuergelder wie möglich erfordern und die Bankeigentümer benachteiligen würden. Der Dodd-Frank Act in den USA zum Beispiel schien zu versprechen, dass die Anteilseigner zuschlagen würden, sollte eine Rettungsaktion für Sparer erforderlich sein. Wenn eine Bank geschlossen und umstrukturiert werden müsste, würden die Anteilseigner Verluste tragen und einige Gläubigerschuldverschreibungen würden in Aktien umgewandelt, was zu erheblichen zukünftigen Verlusten führen könnte. Die Regulierungen in Großbritannien und der Eurozone gingen in ähnliche Richtungen.
Dies waren äußerst willkommene Bemühungen. Die Unterscheidung zwischen Einlegern,die fast nichts über die Geschäfte einer Bank wissen können, und Bankbesitzern, die theoretisch viel mehr wissen und überwachen sollten, ist sehr sinnvoll. Das Problem ist, dass trotz dieses neuen Regelwerks erhebliche Risse bestehen bleiben, was bedeutet, dass Bankmanager immer noch unbeschadet davonkommen – und weiterhin Risiken eingehen werden, die die Stabilität des gesamten Finanzsystems bedrohen. Beispiel SVB: Nach seinem Scheitern wurden Einleger gerettet und Aktionäre gezwungen, Verluste hinzunehmen. So weit, ist es gut. Abgesehen davon, dass einige Führungskräfte an der Spitze fast keine Verluste erlitten – im Gegenteil, sie machten Gewinne. Sie verkauften ihre Aktien zwei Wochen vor dem Scheitern, als es noch keine öffentlichen Informationen über den Zustand der SVB gab, also waren ihre Aktien noch hoch. Das Problem ist, dass sie dies vollkommen legal getan haben.
Finanzaufsichtsbehörden haben das Potenzial für ein solches Verhalten seit langem erkannt und haben Regeln gegen den so genannten Insiderhandel – den Verkauf oder Kauf von Aktien, der durch interne Informationen motiviert ist, die der Öffentlichkeit noch nicht bekannt sind. In gewisser Weise haben Führungskräfte immer mehr Informationen als die Öffentlichkeit, aber man kann sie doch nicht jederzeit daran hindern, ihre Aktien zu verkaufen? Daher wurde ein Gesetz verabschiedet, das besagt, dass eine Führungskraft einen Plan zum Verkauf ihrer Aktien in einem Monat in der Zukunft einreichen kann, da sich öffentliche Informationen ändern und Aktienkurse fallen können.
Die Führungskräfte reichten genau einen solchen Plan ein, und doch wusste die Öffentlichkeit einen Monat später immer noch nichts von den Schwierigkeiten der SVB – die Aktienkurse waren also immer noch hoch und die Führungskräfte profitierten. Es besteht also eine Diskrepanz zwischen dem, was das Gesetz zu erreichen versucht, und dem, was es tatsächlich erreicht. Gerade wurde ein Gesetz verabschiedet, das die Wartezeit auf drei Monate verlängert – aber wird das wirklich das Spiel ändern? In diesem speziellen Fall hätte es, aber in anderen möglicherweise nicht. Man könnte vermuten, dass diese Führungskräfte eine Vorhersage gemacht haben, dass sie nicht bestraft werden würden, also gingen sie diese Risiken ohne viel Risiko ein.
Dies erfordert ein grundlegendes Überdenken der Gesellschafterhaftungsregeln. Wenn Führungskräfte genau entscheiden wollen, wann sie ihre Aktien verkaufen – lassen Sie sie. Aber stellen wir sicher, dass sie mindestens ein Jahr lang für Verluste bei der Bank haften. Auf diese Weise bleiben Führungskräfte frei, zu verkaufen, haften aber noch lange für die Schieflage der Bank.
dp/pos/pcl