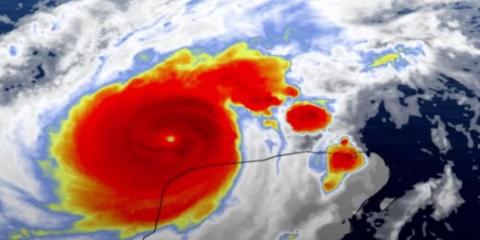Der Medienratgeber "Schau hin!", der unter anderem vom Familienministerium, von ARD, ZDF und der Krankenkasse AOK unterstützt wird, hat einige Tipps für Eltern zusammengefasst. Als Grundregel gelte, dass Nachrichtensendungen für Erwachsene für Kinder unter zehn Jahren ungeeignet seien. "Insbesondere jüngere Kinder können Darstellungen von Kampfhandlungen und Krieg in Nachrichten und Onlinebeiträgen sehr ängstigen. Sie sind noch nicht in der Lage, die Nachrichten zu verstehen", heißt es bei "Schau hin!". Für sie seien altersgerechte Angebote besser geeignet. Auch Kindernachrichtensendungen wie "logo!" würden aktuelle Geschehnisse erläutern und einordnen.
Wenn Kinder Bilder vom Krieg sehen, könnten die Reaktionen ganz unterschiedlich sein. "Je nachdem, wie alt Kinder sind, interessieren sie oft ganz unterschiedliche Aspekte der Ereignisse", heißt es bei "Schau hin!". Manche Kinder würden sich sorgen und sich fragen, ob ihnen ein ähnliches Schicksal widerfahren kann. "Unabhängig davon, wie alt ein Kind ist, will es mit seinen Gefühlen ernst genommen werden", so der Ratschlag des Medienratgebers.
Statt Trauer oder Angst zu beschwichtigen, sollten Eltern besser nachfragen, was ihrem Kind genau Sorgen bereitet. Allein schon, dass Eltern die Gefühle ihrer Kinder wahrnehmen und Interesse zeigen, sei tröstlich. In jedem Fall sei es wichtig, auf die emotionale Lage des Kindes einzugehen und passende Erklärungen zu suchen. In Gesprächen sollten sich Eltern nicht von den eigenen Gefühlen und Ängsten mitreißen lassen und diese so weitergeben. Das versetze Kinder "nur in Panik, gerade wenn sie merken, dass diejenigen, die auf sie aufpassen sollen, selbst schutzlos sind".
Je nach Alter des Kindes empfiehlt der Medienratgeber drei unterschiedliche Strategien für Gespräche über Krieg und Gewalt:
Klein- und Vorschulkinder könnten Fantasie und Realität nicht immer gut trennen. Sie könnten "rascher große und teilweise irrationale Ängste entwickeln, dass ihnen oder ihren Eltern etwas ähnlich Schreckliches passieren könnte". Sie sollten daher wissen, dass die Eltern alles tun, um sie zu schützen.
Schulkinder wüssten bereits, dass Krieg meist in fernen Ländern herrsche. Moralische Fragen von Schuld und Strafe stünden bei ihnen oft im Mittelpunkt. Sie würden häufig fragen, wie es wäre, wenn so etwas bei ihnen passieren würde. Eltern könnten dann "betonen, dass es relativ unwahrscheinlich ist, dass Kriegs- und Terrorschauplätze einen selbst unmittelbar betreffen und viel für Frieden und Terrorabwehr getan wird", so der Tipp. Darüber hinaus könnten Eltern ihre Kinder dazu anregen, ihre Gefühle in einem Bild oder einer Geschichte auszudrücken. Oder sie könnten sie dazu motivieren, Fragen an Redaktionen von Kindernachrichten zu schicken.
Teenager könnten sich "betrogen fühlen", wenn immer wieder Krieg, Gewalt und Terror ausbrechen, "weil sie spüren, dass jede Art von Sicherheit nur eine vorläufige ist, dass niemand sie garantieren kann". In diesem Alter kämen auch bereits "größere ethische und politische Fragen auf" und viele Teenager würden sich an Solidaritätsbekundungen in sozialen Netzwerken beteiligen. Man könne mit ihnen bereits gut "Diskussionen über die Art der Berichterstattung anstoßen" und sie sollten lernen, "Falschmeldungen oder manipulative Beiträge" zu erkennen und im Zweifel selbst nachzurecherchieren.
Marion Schwarz ist stellvertretende Vorsitzende des Berufsverbands der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (BKJ). Wenn Kinder Angst vor einem Krieg hätten, sollten Eltern das nicht abtun. Sie sollten es auch nicht verleugnen, wenn sie selbst beunruhigt sind, empfahl Schwarz. "Man kann ruhig sagen: Auch ich mache mir Sorgen. Aber es ist auch wichtig, sie zu beruhigen, indem man zum Beispiel sagt: Hoffen wir, das alles gut geht, und die Streithähne sich wieder vertragen", so die Expertin.
Wie man Kindern am besten erklärt, was Krieg ist, sei altersabhängig, sagt auch sie. Ihr Vorschlag sind Vergleiche, die für Kinder gut nachvollziehbar sind. "Ich würde ihnen sagen: Auseinandersetzungen kennt jeder, auch du streitest dich mal mit anderen Kindern, deinen Freunden oder Geschwistern. Das ist in der Politik nicht anders, Krieg ist so etwas wie ein schlimmer Streit unter Erwachsenen, bei dem jemand sehr zornig ist. Aber besser ist es dann immer, dass man miteinander redet. Gewalt ist nie eine gute Lösung." Erklären könne man auch, dass es bei Kriegen und Konflikten oft um Grenzen geht und Grenzen sich immer mal verschieben.
Sie geht davon aus, dass Kinder spätestens ab dem Grundschulalter etwas von Kriegen mitbekommen, die in der Berichterstattung präsent sind. Und sie würden es natürlich auch bemerken, wenn die Eltern sich sorgen. "Eltern können ihre Kinder nicht von dem abschirmen, was in der Welt passiert, das geht nicht", so Schwarz.