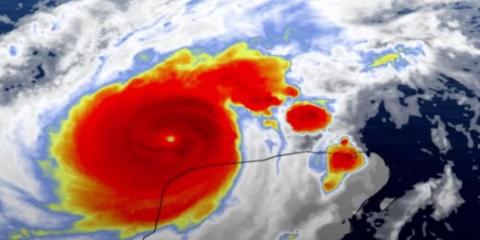Ein Shitstorm im Internet brach los, als ginge es nicht um ein Négligé-artiges Kleidungsstück, sondern um den Fortbestand der Demokratie. "Peinlich", "unfassbar", "ganz übel", war da etwa zu lesen, und "die Republik hat ihren Verstand verloren". Die 46-jährige Grünen-Politikerin wurde ob ihres Outfits mit "Norman Bates‘ Mutter" aus dem Alfred-Hitchcock-Film "Psycho" (1960) verglichen, als "Mann mit Fetisch" verspottet. Und man findet noch viel Gemeineres.
Hinter vielen Posts spürte man Transphobie – die Grünen-Politikerin hieß bis 2019 noch Markus Ganserer. Ähnliche weibliche Oufits kennt man freilich zur Genüge von Abendgesellschaften, Galas, Filmpremieren oder als Bühnengarderobe von Popstars. Ohne dass darüber eine ähnliche Aufregung entsteht.
"Im Deutschen Bundestag gibt es keine ausdrückliche Kleiderordnung", erklärt ein Sprecher der Parlamentsverwaltung. Wohl aber existiert eine von den Abgeordneten verabschiedete Hausordnung, in der ein Verhaltenskodex festgelegt ist. Deren Ziel: die Wahrung der Würde des Parlaments durch dessen Mitglieder und Besucher (und der Schutz der parlamentarischen Arbeit vor Störungen – auch durch Besucher).
Dies gelte im gesamten Bundestag, also auch in den Ausschüssen. Explizit bezieht sich der Sprecher dabei allerdings darauf, dass "Meinungsbekundungen durch Spruchbänder, Flugblätter oder Teile der Bekleidung wie bedruckte T-Shirts oder Trikots nicht der parlamentarischen Ordnung" entsprächen.
Eine diesbezügliche Beschwerde musste sich 2015 die CSU-Abgeordnete Dorothee Bär gefallen lassen, seit Dezember 2021 eine der stellvertretenden Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Am Tag nach der 0:3-Niederlage des FC Bayern München gegen den FC Barcelona trug sie im Parlament aus Solidarität ein FC-Bayern-Trikot unter dem Sakko. Beschwerdeführer war damals der Linken-Politiker Alexander Ulrich, der sich später über das große weiße "T" der Telekom auf dem Vereinsshirt mokiert haben wollte. Die Sache kam vor den Ältestenrat.
Im Jahr davor war Bär bereits im Dirndl im Parlament erschienen. Gegen Trachtenartiges im Hohen Haus hatte sich damals die Grünen-Politikerin Sylvia Kotting-Uhl verwahrt, die dafür auch gleich Twitter einsetzte: "Die Bayern finden‘s passend, der Rest der Welt rückständig." In der Folge: schriftlicher Verbaltumult auf der Plattform. Immer ist wer dagegen.
Es waren die Frauen, die in der Bundesrepublik Schritte aus der unauffälligen Einheitsgarderobe wagten. Und es dauerte eine ganze Weile, bis sie aus den grauen Tönen heraustraten. Die 28 Parlamentarierinnen des ersten Deutschen Bundestags, der am 7. September 1949 zusammenkam, fielen unter den 382 dunkel gekleideten Männern kaum auf, meldeten sich in den ersten sechs Sitzungen auch nicht zu Wort und wurden nicht zu Abendveranstaltungen eingeladen.
Politik war Herrensache – und die Herren pflegten einen Einheitslook, wie aus dem Ei gepellt. Auf offiziellen Kabinettsfotos aus den Anfangstagen der Bundesrepublik sah man sie im Weimarer "Stresemann", einer Kombi aus Cut und Nadelstreifhose. Geschniegelt, gestriegelt oder "tipptopp", wie man zu sagen pflegte. Und aus heutiger Sicht ziemlich langweilig.
Kaum zu glauben, dass der Auftritt der SPD-Frau Lenelotte von Bothmer 1970, als die weibliche Welt Minirock trug, für Empörung sorgte. Die 54-jährige Bremerin stellte sich am 14. Oktober jenes Jahres als erste Frau in einem Hosenanzug ans Rednerpult des Bundestags. Schon im April war sie in diesem Look im Plenum erschienen. Angestachelt hatte sie das frauenfeindliche Statement des CSU-Kollegen und Vizepräsidenten des Bundestages, Richard Jaeger, der zuvor verkündet hatte, keine Frau in Hosen in den Saal, geschweige denn ans Mikrofon zu lassen. Prompt sah Jaeger die Würde der Frau verletzt, der SPD-Grande Carlo Schmid die Würde des Hauses. Der juristisch schwammige Begriff der Würde wurde allen Ernstes gegen ein todschickes Textil ins Feld geführt.
Die Idee zum emanzipatorischen Zeichen hatte Jaegers Amtskollegin Liselotte Funcke (FDP) gehabt, die die leidenschaftliche Rockträgerin von Bothmer von der Notwendigkeit des Looks überzeugte. Auch damals gab es einen – indes analogen – Shitstorm. Anonyme Wut- und Hassbriefe trafen bei von Bothmer ein. Dabei war auch in diesem Fall die deutsche Politik nur hoffnungslos hinterher. Der Hosenanzug war bereits in den Dreißigerjahren des vergangenen Jahrhunderts das Erkennungsmerkmal des Kino- und Gesangsweltstars Marlene Dietrich gewesen.
Was mit des einen Würde wunderbar zu vereinen ist, ist dem anderen unfassbar. 1983, als kein Hahn mehr nach skandalösen Hosen an Parlamentarierinnenbeinen krähte, echauffierte sich das Krawattenland an den Pulli- und Latzhosenträgerinnen und -trägern im Plenarsaal. Konservative politische Kräfte kamen sich angesichts der erstmals in den Bundestag eingezogenen Grünen vor wie im Laurel Canyon der Hippiezeit.
Männer mit langen Haaren und ungestutzten Bärten sowie Frauen ohne Make-up machten da jetzt Politik und polarisierten durch Optik. Unter der Regierung von Bundeskanzler Gerhard Schröder trugen die Grünen-Minister dann in den Nullerjahren schon Binder zu Zwei- und Dreiteilern, die Ministerinnen legten Rouge auf und zogen Kostüm respektive Hosenanzug an.
Die Grünen-Vorstandssprecherin Gunda Röstel allerdings posierte 2000 – nicht im Plenum, sondern im Magazin "Life & Style" – ganz ungrün in knallenger schwarzer Lederhose. Sie habe dies einer Moderedakteurin zugesagt, "weil es für das Image meiner Partei nicht schlecht ist, wenn Jürgen Trittin oder ich zeigen, dass modernes, gutes Outfit auch zu den Facetten der Grünen gehört".
Ganz Berlin redete in jenen Tagen laut einer chauvinistischen Einlassung des "Spiegel" über Röstels Beine – so wie acht Jahre später das ganze Land nach der Opernhaus-Eröffnung in Oslo über das Dekolleté der gemeinhin hochgeschlossenen Kanzlerin redete. Auch für Röstel gab es böse Worte – die "taz" nannte die Grüne, die in der Zeitschrift auch elegant im grünen Abendkleid zu sehen war, die "Gurke des Tages".
Der Mut zum besonderen Kleidungsstück, zu Form, Farbe, Accessoire schafft Erinnerungen an Politikerinnen und Politiker: Für die Geschichte bleibt, dass Angela Merkel Dankesreden im grünen Blazer hielt, bei harten Verhandlungen hingegen rote Exemplare bevorzugte. Walter Momper, der frühere Regierende Bürgermeister von Berlin, ist bundesweit für alle Zeit der Mann mit dem roten Schal.
Man erinnert sich an keinen der vielen Anzüge von CDU-Bundeskanzler Helmut Kohl im Besonderen, wohl aber an seine Strickjacken-Diplomatie mit Michail Gorbatschow – etwa 1990 beim Treffen im Kaukasus. Und sieht man eine Hamburger Elblotsenmütze, stellt man sich im Geiste den SPD-Kanzler Helmut Schmidt darunter vor.
Dass der Bundestag sich irgendwann von Modezwängen befreien wird, steht zu hoffen, aber nicht zu erwarten. 2011 wurde die "Würde des Hauses" und damit auch die Kleidungsfrage in den Schutzbereich von Ordnungsmaßnahmen aufgenommen. 1000 Euro, im Wiederholungsfall 2000 Euro, können vom sitzungsleitenden Präsidenten bei einer "nicht nur geringfügigen Verletzung der Ordnung oder der Würde des Bundestages" festgesetzt werden.
Dem Grünen-Abgeordneten Özcan Mutlu und seinen Fraktionskollegen Chris Kühn und Dieter Janacek wurde die Geldstrafe von Bundestagspräsident Norbert Lammert im März 2017 immerhin angedroht, nachdem sie im Plenarsaal in T-Shirts mit der Aufschrift "#FreeDeniz" stehend für die Freilassung des deutschen Korrespondenten Deniz Yücel aus türkischer Haft protestiert hatten. Keine Slogans. Niemals.
Das ist nachvollziehbar, sonst wären wohl bald auch Shirts mit rechts-extremen Sprüchen oder Symbolen im Reichstagsbau zu sehen – zumindest auf den Tribünen. Ob deutsche Wählerinnen und Wähler von den Gewählten aber eine Unterwerfung unter einen die Seriösität des Amts spiegelnden Kleidungsstil erwarten, ist zu bezweifeln. Gute Politik für eine gute Zukunft wahrt die Würde des Hauses wohl am besten.
Offizielle Lockerungen erfolgen Schrittchen für Schrittchen und sind zuweilen eher erheiternd. 2014 wurde der Krawattenzwang für Schriftführer abgeschafft. Die Fraktionen der Grünen und Linken hatten nach einer Posse um drei den Schlips verweigernde Bundestagsschriftführer Schwierigkeiten gehabt, überhaupt noch Abgeordnete für die Aufgabe zu finden. "Mit der Abschaffung des Krawattenzwangs haben wir die Fenster im Bundestag ein gutes Stück weiter aufgestoßen und viel Muff entweichen lassen", sagte Gründen-Präsidiumsmitglied Claudia Roth damals.
Dass den Deutschen generell der Sinn für die Mode fehle, erklärte die Stilberaterin Stefanie Diller vor drei Jahren im Wochenmagazin "Die Zeit". Auch in Firmen, wo für Kundenkontakt Textilseriösität immer das A und O war, wo Kleider Leute und Geschäfte machten, werde es lockerer. Dillers These: Das Outfit macht den Meister. Wer gut und hochwertig angezogen sei, fühle sich attraktiver, wirke kompetenter, sei erfolgreicher. Aufweichungen von Dresscodes in die privat getragene Garderobe führe zu Narrenfreiheit.
Ob Tessa Ganserer ihr Ausschussoutfit in den eigenen vier Wänden trägt, ist nicht bekannt. Ein Zusammenhang mit der vom Familienausschuss verhandelten trans Thematik und der luftigen Kleidung ließe sich durchaus herstellen.
Man kann die Schleierbluse deshalb, so man will, als politisches Statement werten und in diesem Zusammenhang über die "Würde des Hauses" ähnlich diskutieren wie beim Yücel-Shirt. Oder man nimmt Ganserers Kleidung an jenem Tag einfach als Ausdruck ihrer Freude an der neuen Geschlechtsidentität. Würdelos sind in jedem Fall – egal wie schwammig der Würdebegriff nun ist – die hass- und wutspuckenden Diskriminierungsposts bei Twitter.
Ob auch Ganserers Look vor den Ältestenrat kommt, hängt davon ab, ob Echauffierte einer Fraktion ihn dort als unangemessen thematisieren, wie es damals bei Dorothee Bär der Fall war. Was für Bär dabei herausgekommen ist? Das wurde nicht bekannt. Der Ältestenrat ist nicht Robespierres Wohlfahrtsaussschuss, er verhängt keine Strafen, er tagt zudem nicht öffentlich und ist diskret, leitet seine Diskussionsergebnisse, so eine Pressesprecherin des Bundestags gegenüber, so gut wie nie an die Medien weiter.