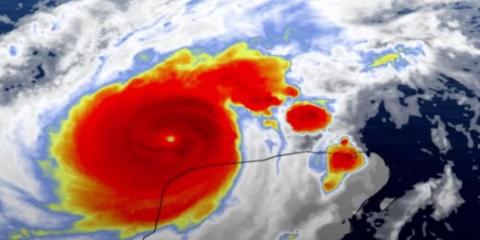Das "ethnisch-kulturell geprägte Volksverständnis" der AfD stehe im Widerspruch zur Offenheit des Volksbegriffs des Grundgesetzes, heißt es im Bericht. Es würden "rechts-extremistische und verschwörungstheoretische Narrative bedient" sowie "ausländer- und muslimfeindliche Positionen". Auch gebe es Anhaltspunkte für antisemitische Positionen, darüber hinaus "Diffamierungen und Verunglimpfungen politischer Gegner sowie des Staates und seiner Repräsentanten".
Die AfD wehrt sich juristisch gegen die Einstufung als Verdachtsfall und wirft dem Verfassungsschutz vor, die Partei aus politischen Gründen zu diskreditieren. Die AfD werde zur "politisch Verfolgten gemacht", sagte Parteichefin Alice Weidel letztes Jahr dem "Stern". Zur Debatte über ein Verbot will die Partei nichts sagen.
Befürworter gibt es in fast allen demokratischen Parteien, allerdings nicht durchgängig. In der SPD ist Parteichefin Saskia Esken eher dafür, der Ostbeauftragte Carsten Schneider dagegen. In der CDU plädiert der Sachse Marco Wanderwitz für ein Verbot, der Parteichef Friedrich Merz nicht.
Auch Befürworter äußern sich oft vorsichtig abwägend und räumen ein, dass eigentlich politische Argumente gegen die AfD zählen sollten. Doch sagt der Grünen-Politiker Konstantin von Notz auch: "Die AfD ist eine unsere Demokratie zutiefst verachtende Partei." Der Linken-Vorsitzende Martin Schirdewan nennt die AfD eine "Gefahr für die Demokratie" und meint: "Die Option eines Parteienverbotes darf nicht voreilig aus der Hand gelegt werden."
Das Grundgesetz setzt hohe Hürden, denn Parteien stehen unter dem Schutz der Verfassung. Verbotsanträge können die Bundesregierung, der Bundestag oder der Bundesrat stellen. Es entscheidet das Bundesverfassungsgericht. Voraussetzung für ein Verbot ist, dass die Partei "nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger" beabsichtigt, "die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden".
Seit Gründung der Bundesrepublik gab es erst zwei Parteiverbote: 1952 trifft es die Sozialistische Reichspartei (SRP), der Wesensverwandtschaft mit Adolf Hitlers NSDAP attestiert wurde. 1956 folgt die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD), deren Ziel es ist, eine "Diktatur des Proletariats" zu errichten.
Ein von Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung beantragtes Verbot der rechts-extremen NPD (heute: Die Heimat) scheiterte hingegen vor dem Bundesverfassungsgericht. Die Richter stellten 2017 zwar fest, die NPD vertrete "ein auf die Beseitigung der bestehenden freiheitlichen demokratischen Grundordnung gerichtetes politisches Konzept". Doch fehle es "an konkreten Anhaltspunkten von Gewicht, die es möglich erscheinen lassen, dass dieses Handeln zum Erfolg führt". Kurzum: Es reicht nicht, dass eine Partei verfassungsfeindliche Ziele verfolgt, es muss auch plausibel sein, dass sie sie erreichen kann.
Das NPD-Urteil dient jetzt Gegnern wie Befürwortern eines AfD-Verbots als Argumentationshilfe. Die einen sagen: Es dürfte auch im Fall der AfD schief gehen. Die anderen meinen: Anders als die NPD ist die AfD inzwischen so groß, dass das Kriterium "könnte Ziele durchsetzen" erfüllt wäre. Wie immer in juristischen Fragen ist der Ausgang offen.
Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hält ein Verbotsverfahren "verfassungsrechtlich für nahezu aussichtslos und politisch problematisch". Um der AfD den Wind aus den Segeln zu nehmen, müsse man politische Lösungen anbieten.
Der Düsseldorfer Parteienforscher Thomas Poguntke sieht das genauso. "Ich halte es nicht für den richtigen Weg, dass man eine Partei verbietet", sagt Poguntke der Deutschen Presse-Agentur. "Ein erheblicher Teil der Wähler der AfD ist nicht rechts-extrem. Die muss man zurückgewinnen auf politischem Wege." Dazu müssten Parteien kritisch hinterfragen, ob sie wirklich Politik für die Mehrheit der Wähler machten. Andernfalls müssten sie bessere Lösungen anbieten. "Dadurch ließe sich für die Demokratie mehr erreichen, als durch ein Verbot."
Aber auch die Politikwissenschaft ist uneins. Man müsse alle Optionen diskutieren, um den Schutz des liberalen Rechtsstaat zu garantieren, sagt der Magdeburger Rechts-Extremismus-Experte Matthias Quent. Das schließe auch eine Debatte über ein Verbotsverfahren ein. Diese sollte nicht anhand von Umfrageergebnissen oder Wahlterminen geführt werden, sondern anhand konkreter Befunde, sagt Quent.