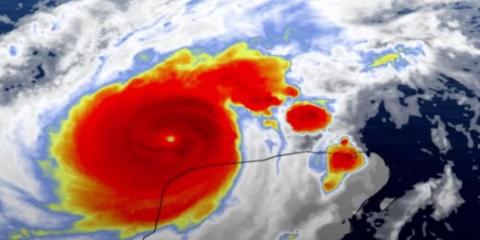Doch dieser Tage vergeht selbst den Briten das Lachen. Davon kann auch Joe Cox berichten. Er arbeitet für die Organisation Debt Justice in London. Diese will der Ausbeutung von Menschen durch Schulden ein Ende bereiten. Die Organisation hat ihren Sitz im Oxford House, einem Gemeindezentrum im Stadtbezirk Tower Hamlets östlich der City of London. "Wenn ich hier aus der Türe gehe, werde ich sofort mit den Problemen, mit denen wir uns beschäftigen, konfrontiert", sagt der 37-Jährige. "Es gibt es ein hohes Maß an Armut und Ungleichheit sowie schlechte Wohnverhältnisse und all die Probleme, die damit einhergehen."
Weil neben den Lebenshaltungskosten auch die Mieten sowie die Hypothekenzinsen in Großbritannien immer weiter stiegen, gerieten viele Menschen extrem unter Druck. Oft sähen sie dann keinen anderen Ausweg, als einen Kredit aufzunehmen – zu schlechten Konditionen. Was die finanzielle Last noch weiter erhöht. Eine neue Analyse von Debt Justice hat ergeben, dass die Zahl der Haushalte, die unter hohen Schulden leiden, seit 2017 um zwei Drittel gestiegen ist. 12,8 Millionen Menschen sollen betroffen sein.
Gerade junge Briten sehen auf der Insel mittlerweile keine Perspektive mehr. Rekordzahlen an Erwachsenen leben immer noch bei ihren Eltern. Denn wer auszieht, muss jüngsten Erhebungen zufolge damit rechnen, mehr als die Hälfe seines Einkommens für die Wohn- und Nebenkosten auszugeben. Eine Analyse der Denkfabrik Resolution Foundation ergab, dass Haushalte mit mittlerem Einkommen in Großbritannien 9 Prozent ärmer sind als jene in Frankreich. Sam Ashworth-Hayes, Journalist bei der Zeitung "Telegraph", riet deshalb kürzlich: "Verlassen Sie das Schiff, solange Sie noch können."
In Großbritannien haben die gestiegenen Lebenshaltungskosten dazu geführt, dass den Bürgern das Geld ausgeht. Erschwerend hinzu kommt die schlechtere Ausgangslage. Kaum ein großes Industrieland wurde von der Finanzkrise so hart getroffen: Auch heute noch verdienen Arbeitnehmer auf der Insel weniger als in anderen Ländern. Die Reallöhne liegen nach wie vor nur knapp über dem Niveau von 2008, auch weil der Brexit das Wachstum hemmte. Und: "Die Sozialleistungen reichen mittlerweile selbst für Erwerbstätige nicht mehr aus", erklärt Isabel Taylor von der "Joseph Rountree Foundation".
Der große Frust über die Regierung spiegelt sich in den Umfragen. Demnach ist Premierminister Rishi Sunak heute genauso unbeliebt wie einst Boris Johnson, als dieser im Juli 2022 sein Amt niederlegte. Und das, obwohl Sunak im Oktober vergangenen Jahres in seiner Antrittsrede betont hatte, dass er Dinge anders machen wolle als sein Vorgänger: Professionell wolle er sein und die Bedürfnisse der Menschen ins Zentrum stellen. Laut einer YouGov-Umfrage haben jedoch 67 Prozent "keine gute Meinung" von ihm. Die oppositionelle Labour-Partei liegt hingegen rund 20 Punkte vor den Tories. Damit droht der konservativen Partei bei den nächsten Wahlen eine krachende Niederlage.
Als einen letzten Rettungsanker plant die Regierung die Parlamentswahlen im kommenden Jahr relativ spät anzusetzen, wie Regierungsbeamte hinter vorgehaltener Hand berichten. Sunak setzt dabei darauf, dass sich die wirtschaftliche Lage im Land bis dahin etwas entspannt hat. Die Aussichten dafür sind gut, wie Adam Corlett von der Denkfabrik Resolution Foundation sagt. Er prognostiziert für das Jahr 2024 eine sinkende Inflation. Zwar verbessern sich in der Folge die wirtschaftlichen Aussichten, "die Einkommen der Haushalte mit geringerem Einkommen werden jedoch wohl weiter sinken".
Kelly Beaver von dem Meinungsforschungsinstitut Ipsos bezweifelt deshalb, dass diese Nachrichten die Wähler im Vereinigten Königreich beeindrucken werden. "Haushalte der unteren und mittleren Mittelschicht sehen nicht wirklich, dass sich das auf sie auswirkt." Und: "Wenn die Sorgen um die Wirtschaft nachlassen, rücken andere Dinge auf der Prioritätenliste nach oben" wie das nationale Gesundheits- oder das Schulsystem – und damit Bereiche, in denen es an allen Ecken und Enden fehlt.
Schließlich steckt das Gesundheitssystem NHS in der schlimmsten Krise seit seiner Gründung. Legte schon im vergangenen Jahr eine große Streikwelle weite Teile des öffentlichen Lebens lahm, setzt sie sich diesen Herbst fort. Ende September wollen Assistenz- und Chefärzte zum ersten Mal mehrere Tage gemeinsam ihre Arbeit niederlegen, um ein besseres Gehalt zu erstreiten; aber auch, um auf die verheerenden Verhältnisse in dem Gesundheitssystem aufmerksam zu machen. "Als die Pandemie den NHS traf, war die Resilienz bereits sehr, sehr gering", betont Stuart Hoddinott von der Denkfabrik "Institute for Government". Im Januar dieses Jahres warteten Menschen mit einem Schlaganfall, schweren Verbrennungen oder Brustschmerzen laut dem NHS England im Schnitt 93 Minuten auf einen Krankenwagen. Die Zahl jener Engländer, die auf eine routinemäßige Behandlung in einer Klinik warten, hat diese Woche einen neuen Rekordwert erreicht.
Eltern und Schulleiter reagieren außerdem geschockt auf den Skandal um "Pfuschbeton". Anfang des Monats ließ die konservative Regierung nur wenige Tage vor dem offiziellen Unterrichtsstart mehr als 100 Gebäude ganz oder teilweise schließen. Ursprung des Problems ist die Verwendung eines Porenbetons namens RAAC. Er ist günstiger, aber weniger robust und hat deshalb nur eine Lebensdauer von wenigen Jahrzehnten. Regelmäßige Wartungsarbeiten seien deshalb unerlässlich, wie Experten betonen. Diese seien jedoch nicht erfolgt; oder zumindest nicht in ausreichendem Maße, wie Gareth Davies, Leiter der National Audit Office (NAO), dem nationalen Rechnungsprüfungsamt, sagt. Das Problem sei durch "jahrelange mangelnde Investitionen" verursacht worden. Die Betonkrise, so sagen viele Kritiker, sei die perfekte Metapher für das zerbröselnde Königreich, das von der Tory-Regierung mehr als zehn Jahren kaputtgespart wurde.
Um zu verstehen, wie es so weit kommen konnte, muss man laut Joe Cox jedoch einen weiteren Blick in die Vergangenheit werfen, bis in die 80er-Jahre nämlich. Die damalige Premierministerin Margaret Thatcher sowie ihr Nachfolger John Major privatisierten viele öffentliche Unternehmen. So sollten Steuern gespart und die Effizienz erhöht werden. Die Maßnahmen zahlten sich aus, eine Weile zumindest. Langfristig brachte sie jedoch nicht den gewünschten Erfolg, wie sich mittlerweile in Großbritannien zeigt.
"Das englische Wasserversorgungsunternehmen Thames Water etwa verliert knapp ein Viertel des Leitungswassers durch Lecks", erklärt der britische Umweltjournalist Tim Smedley. Seit 1991 sei kein neuer Stausee mehr gebaut worden. "Im Gegenteil, statt in die Infrastruktur zu investieren, nahmen die Unternehmen hohe Geldbeträge auf und gaben den Großteil dann an ihre Aktionäre weiter." Allein Thames Water habe derzeit Schulden in Höhe von 14 Milliarden Pfund (mehr als 16 Milliarden Euro). "Im Fall einer Insolvenz wäre die offensichtliche Lösung die Verstaatlichung. Schließlich geben selbst überzeugte Verfechter der Privatisierung zu, dass diese gescheitert ist."
Ein Schlaglicht auf die Folgen dieser Politik warf auch das fatale Feuer im Grenfell Tower. Bei dem Brand eines Wohnturmes im Londoner Viertel North Kensington starben im Jahr 2017 mehr als 70 Menschen. "Der Brand von Grenfell war nicht unvermeidlich – es war ein Verbrechen, das durch jahrzehntelange Deregulierung, Privatisierung und die Priorisierung des Profits vor der Sicherheit verursacht wurde", sagte Matt Wrack, Chef der Fire Brigades Union anlässlich des sechsten Jahrestages des Unglücks im Juni. Mitte der 1980er-Jahre wurden die Brandschutznormen in Wohnhäusern und dereguliert, auf verpflichtende Richtlinien für die Bauindustrie weitestgehend verzichtet. Ein Kurs, an welchem auch die Labour-Regierung unter Tony Blair festhielt.
Seit Thatcher sind Sozialwohnungen überdies Mangelware. Millionen erschwinglicher Lebensraum durfte verkauft werden. Seitdem regelt damit überwiegend der Markt die Mietpreise – und diese steigen seit Jahren immer weiter. Die 55-jährige Kay Ballard ist deshalb froh, dass sie in einem Sozialbau wohnen kann, auch wenn es schwierige Bedingungen sind. Seit Jahren kämpft sie darum, dass ihr Zuhause im Londoner East End modernisiert wird, bislang vergeblich. Nun will sie gemeinsam mit einigen anderen Bewohnern das Gebäude wenigstens säubern und neu streichen – auf eigene Faust. Die einstige Postbotin und Mutter von zwei Kindern ist seit einem Unfall in jungen Jahren arbeitsunfähig und hat lange darum gekämpft, finanzielle Unterstützung zu erhalten. "Nun beschäftige ich mich, indem ich anderen helfe."
Ob die Menschen die Situation in Großbritannien weiterhin so relativ gelassen hinnehmen werden? Ballard erinnert an die Aufstände im Jahr 2011. Der Tod eines Schwarzen durch die Londoner Polizei löste damals in mehreren britischen Großstädten heftige Krawalle von Jugendlichen aus. Tagelang zogen gewalttätige Gangs durch die Straßen, fünf Menschen starben, zahlreiche wurden verletzt, Hunderte Läden geplündert. Ballard vergleicht die Situation in Großbritannien mit einem Vulkan. "Briten bleiben lange ruhig, aber manchmal kann eine bestimmte Sache plötzlich einen großen Aufstand erzeugen."
dp/fa