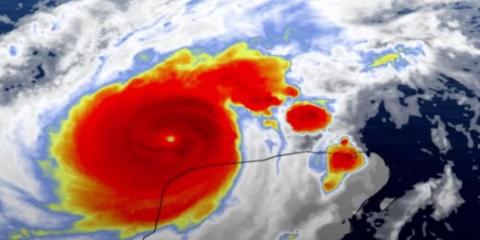"Psychische Erkrankungen entwickeln sich eher langsam", sagte Dietrich Munz, Präsident der Landespsychotherapeutenkammer. "Wir haben deshalb damit gerechnet, dass sie sich nach dem Rückgang der Corona-Zahlen weiter bemerkbar machen." Allerdings seien psychische Erkrankungen auch weniger ein Tabu-Thema als früher. "Es wird weniger stigmatisiert und es wird offener darüber gesprochen und es wird auch häufiger diagnostiziert, weil Betroffene frühzeitiger zum Arzt gehen."
Teilweise wird eine Belastung über ein bis zwei Jahre getragen, bevor sie sich Bahn bricht, sagt auch Gabriele Glocker vom Landesverband der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen. "Viele Menschen, Kranke und auch ihr Umfeld, stecken einen enormen Druck für kurze Zeit weg, aber das ist nicht von Dauer", erklärt sie. Aber nach Corona kam der Krieg in der Ukraine hinzu, die Energiedebatte und die Preiskrise. "Einzeln genommen mag das überschaubar sein, aber es addiert sich und wirkt sich aus", sagt Glocker. Und stets sei nicht nur ein Erkrankter oder eine Kranke betroffen, es gehe auch um Freunde, Partner und Eltern.
Laut DAK-Report ist vor allem die Belastung bei jungen Frauen im Alter zwischen 15 und 19 Jahren im vergangenen Jahr deutlich gestiegen, bei den Männern dagegen die Altersgruppe der 35- bis 39-Jährigen. Unter Druck stand auch im vergangenen Jahr weiter das Gesundheitswesen. Die Zahlen dieser Branche lagen nach DAK-Angaben 43 Prozent über dem Durchschnitt der Ausfälle. Psychische Erkrankungen sind zudem oft langwierig. Im Durchschnitt waren die Betroffenen im vergangenen Jahr 36,9 Tage lang krankgeschrieben, mehr als jeder vierte davon bis zu drei Tage, jeder siebte länger als 42 Tage. Vor allem handelt es sich laut Report um Depressionen, die auf einem Rekordhoch liegen, sowie um Belastungs- und Anpassungsstörungen. Den stärksten Anstieg mit 39 Prozent Zuwachs gegenüber 2021 hatten Angststörungen.
"Wir sehen eine hohe Zahl an Erschöpfungsdepressionen und an Entlastungsdepressionen, wenn es zuvor eine Anfälligkeit dafür gab", sagt Martin Bürgy, Psychiater und Leiter des Zentrums für Seelische Gesundheit am Klinikum Stuttgart. "Wenn nach der Pandemie eigentlich Entlastung möglich wäre, wird deutlich, wie belastet man eigentlich ist." Es handele sich in der Statistik allerdings auch nicht ausschließlich um Neuerkrankungen. Vielmehr seien es oft Vorerkrankungen, die durch äußere Umstände wie die Pandemie und die fortgesetzte Belastung verstärkt würden. Die Zahl der psychischen Erkrankungen steige zudem seit vielen Jahren. "Corona hat da wie ein Brennglas gewirkt", sagt Bürgy.
Das Problem: Wie in etlichen anderen Branchen auch fehlt es an fachlich ausgebildetem Nachwuchs. Die Zahl der Fälle steigt, die Zahl der Hilfen und Experten nicht. Die DAK fordert nicht nur deshalb, bereits deutlich früher einzugreifen und zu helfen. "Der neue Höchststand bei den psychischen Erkrankungen im Südwesten ist ein Alarmsignal für uns alle", sagte Siegfried Euerle, der Landeschef der DAK-Gesundheit in Baden-Württemberg. "Hinzu kommt, dass zunehmend auch jüngere Männer in der Mitte ihres Arbeitslebens wegen dieser Erkrankungen ausfallen." Den Fragen der seelischen Gesundheit müsse am Arbeitsplatz mehr Beachtung geschenkt werden, forderte er. "Beschäftigte dürfen nicht Gefahr laufen, eines Tages verfrüht ausgebrannt zu sein und aussteigen zu müssen."
Für den Psychreport hat das Berliner IGES Institut die Daten von 275.000 DAK-versicherten Beschäftigten in Baden-Württemberg ausgewertet. Die DAK-Gesundheit ist nach eigenen Angaben die drittgrößte gesetzliche Krankenkasse Deutschlands mit rund 630.000 Versicherten im Südwesten.
dp/pcl