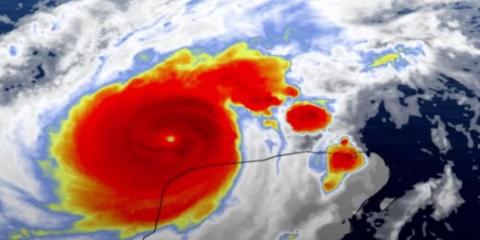"Eine solche Regel ist nicht diskriminierend, wenn sie allgemein und unterschiedslos auf das gesamte Personal dieser Verwaltung angewendet wird und auf das unbedingt Notwendige beschränkt ist", hieß es. Das Gericht wurde um eine Entscheidung gebeten, nachdem einer muslimischen Mitarbeiterin in der Gemeinde Ans im Osten Belgiens mitgeteilt worden war, sie dürfe bei der Arbeit kein Kopftuch tragen. In Gerichtsakten wurde festgestellt, dass ihr Job kaum Kontakt zur Öffentlichkeit beinhaltete. Bald darauf änderte die Gemeinde ihre Beschäftigungsbedingungen und verlangte von allen Mitarbeitern eine strikte Neutralität. Die Mitarbeiterin reichte beim örtlichen Gericht Beschwerde ein, in der sie das Verbot als diskriminierend bezeichnete und Bedenken äußerte, dass ihr Recht auf Religionsfreiheit verletzt worden sei.
Das Gericht stellte fest, dass offensichtliche Anzeichen einer religiösen Überzeugung zwar verboten seien, mehrere vom Beschwerdeführer vorgelegte Fotos jedoch deutlich machten, dass "verdeckte Anzeichen einer Überzeugung toleriert würden". Zu diesen Symbolen gehörte das Tragen von Ohrringen mit einem Kreuz oder das Abhalten von Weihnachtsfeiern, sagte der Anwalt des Beschwerdeführers. Das Gericht wandte sich an die EU und forderte den Gerichtshof auf, zu beurteilen, ob die Neutralitätsregel diskriminierend sei.
In einer Entscheidung, die für Ämter des öffentlichen Sektors in der gesamten EU gilt, erklärte das in Luxemburg ansässige Gericht, dass eine Politik der strikten Neutralität "als durch ein legitimes Ziel objektiv gerechtfertigt angesehen werden kann". Es stellte jedoch fest, dass auch das Gegenteil der Fall wäre: Öffentliche Verwaltungen könnten berechtigt sein, ihren Mitarbeitern allgemein und unterschiedslos das Tragen sichtbarer Zeichen des Glaubens, sei es religiöser oder philosophischer Art, zu gestatten.
Nationale Gerichte verfügten über einen "Ermessensspielraum", der es ihnen ermögliche, zu entscheiden, wie sie die Rechte des Einzelnen und die Neutralität des öffentlichen Dienstes am besten in Einklang bringen könnten. "Dieses Ziel muss jedoch konsequent und systematisch verfolgt werden und die zu seiner Erreichung ergriffenen Maßnahmen müssen auf das unbedingt Notwendige beschränkt sein", hieß es. Sibylle Gioe, die Anwältin, die den Arbeitnehmer in Belgien vertritt, betonte die Mehrdeutigkeit des Gerichtsurteils. "Das Recht der Europäischen Union entscheidet sich nicht für eine Lösung gegenüber einer anderen", sagte sie. "Und ich hatte so etwas erwartet."
Die Nachricht vom Urteil löste in manchen Kreisen Besorgnis aus. Femyso, ein europaweites Netzwerk, das mehr als 30 muslimische Jugend- und Studentenorganisationen vertritt, bezeichnete das Urteil als potenzielle Verletzung der Religions- und Meinungsfreiheit. "Obwohl es neutral getarnt ist, zielen Verbote religiöser Symbole ausnahmslos auf das Kopftuch ab", sagte die Organisation und zitierte ein Papier der Open Society Foundations aus dem Jahr 2022, in dem argumentiert wurde, dass diese Verbote auf islamfeindlichen Diskursen beruhen, die islamische Kleidung als unvereinbar mit Neutralität darstellen.
Das Urteil könnte die Marginalisierung muslimischer Frauen in einer Zeit verschärfen, in der die Islamfeindlichkeit zunahm, hieß es und fügte hinzu: "Muslimische Frauen sind bereits aus mehreren Gründen intersektioneller Diskriminierung ausgesetzt, und ein solches Urteil birgt die Gefahr, ihre Entfernung aus dem öffentlichen Leben zu legitimieren." Die Organisation forderte "Inklusivität am Arbeitsplatz, an der Menschen aller Glaubensrichtungen, einschließlich muslimischer Jugendlicher, uneingeschränkt teilnehmen können, ohne Angst vor Diskriminierung haben zu müssen".
Die Entscheidung vom Dienstag spiegelte mehrere frühere Urteile desselben Gerichts wider. Im Jahr 2021 wurde entschieden, dass Arbeitgeber im privaten Sektor die Äußerung religiöser, politischer oder philosophischer Überzeugungen einschränken dürfen, wenn ein "echtes Bedürfnis" besteht, "ein neutrales Bild gegenüber Kunden zu vermitteln oder soziale Auseinandersetzungen zu verhindern". Ein Jahr später hieß es, solche Verbote stellten keine "unmittelbare Diskriminierung" dar, solange sie für alle Arbeitnehmer gleichermaßen gelten.
Zu denjenigen, die die Entscheidung von 2021 kritisierten, gehörte auch Human Rights Watch. "Muslimische Frauen sollten sich nicht zwischen ihrem Glauben und ihrem Beruf entscheiden müssen", sagte Hillary Margolis von der Organisation damals in einer Erklärung. Solche Einschränkungen, sagte sie, konzentrierten sich oft auf muslimische Frauen, die Kopftücher oder Gesichtsschleier trugen, und beruhten auf einer fehlerhaften Logik: "Dass die Einwände eines Kunden gegen Mitarbeiter, die religiöse Kleidung tragen, berechtigterweise über die Rechte der Mitarbeiter hinausgehen können."