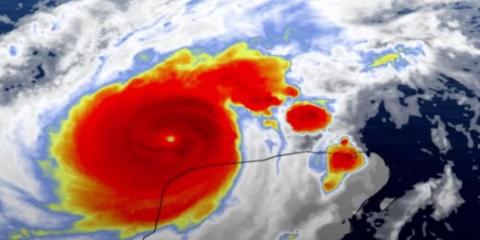Das Thema der Kundgebung ist Krieg: "Nein zu Kriegen – Rüstungswahnsinn stoppen – Zukunft friedlich und gerecht gestalten". Die Initiatoren verurteilen den russischen Angriff und zugleich die Nato, beide in einem Atemzug. Sie fordern einen Waffenstillstand und Verhandlungen mit Russland. Fest steht: Es werden viele kommen. 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind angekündigt – sie kommen vor allem wegen ihr: Sahra Wagenknecht.Man muss der 54‑Jährigen zugestehen: Momentan ist sie die wohl aufregendste, weil kurzweiligste politische Kraft der Bundesrepublik. Noch nie hat in Deutschland allein die Ankündigung einer Parteigründung ein derart großes Aufsehen ausgelöst.
Selbst als Phantom wirbelt das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), Keimzelle der künftigen Partei, in Umfragen bereits mächtig Staub auf: Einer Insa-Umfrage im Auftrag der "Bild"-Zeitung von Ende Oktober zufolge käme eine Wagenknecht-Partei bundesweit auf 12 Prozent – gleichauf mit den Grünen. Größter Verlierer der Parteigründung wäre demnach die AfD. Wohlgemerkt: Der Zeitpunkt der Umfrage lag vor dem derzeitigen Chaos nach dem Urteilsspruch des Bundesverfassungsgerichts zum Haushalt der Ampelkoalition. Tendenziell hätte Wagenknechts Bündnis in Umfragen seitdem wohl eher zugelegt.
Was also ist das Erfolgsgeheimnis dieser politischen Unruhestifterin? Moritz Rudolph, Politikwissenschaftler und Redakteur des "Philosophie-Magazins", hat Sahra Wagenknechts politische Agenda "seziert" und einer ideologischen Einordnung unterzogen. Und kommt zu dem Schluss, dass Wagenknecht "weder links noch rechts ist" sondern als Kernbotschaft "an die Sehnsucht nach der guten alten Bundesrepublik anknüpft", wie er betont. "Natürlich kommt Wagenknecht aus der linken Tradition, sie war Teil der ‚Kommunistischen Plattform‘ innerhalb der Linken, vertrat teils sogar linksradikale Thesen, doch das hat sie schnell hinter sich gelassen", so Rudolph.
Heute betont sie gern, dass sie eine überzeugte Marktwirtschaftlerin ist, die von Enteignungen und Vergesellschaftung nichts hält. Rudolph: "Einige Kommentatoren sehen in ihr eine Schumpeterianerin …", die wie der österreichische Nationalökonom Joseph Schumpeter "innovative Unternehmer gegenüber gierigen Kapitalgebern stärken will". Eine Fürsprecherin der sozialen Marktwirtschaft also.
Da noch keine Partei existiert, also auch kein Parteiprogramm, lässt sich Wagenknechts politischer Kosmos nur aus ihren Äußerungen skizzieren. Daraus ergibt sich eine Agenda, die eher an einen politischen Bauchladen erinnert, der sich, ohne auf ideologische Barrieren zu achten, aus fast allen Lagern bedient. Ist das vielleicht ihr Erfolgsrezept? "Wagenknecht bewegt sich auf die Mitte zu, sie bedient die Sehnsucht nach der guten alten Bundesrepublik, in der ‚Wohlstand für alle‘ herrschte und die Souveränität beim Staat lag und sich noch nicht in den unendlichen Weiten der Globalisierung verflüchtigt hatte", so Moritz Rudolph, der als Redakteur beim "Philosophie-Magazin" arbeitet. Rudolph: "Die Welt war intakt und auf die Mitte zugeschnitten: Kleine Unternehmen, gebändigtes Finanzkapital, relativ gleiche Einkommensverteilung, ein geschlossener Nationalstaat."
Jede erfolgreich gegründete Partei in Deutschland hatte ihr Narrativ, wie man das heute ausdrückt – ihre politische Kernbotschaft also, die gesellschaftliche Bedürfnisse bediente: Für die SPD war vor 150 Jahren der Kampf für mehr soziale Gerechtigkeit für die neu entstandene Arbeiterklasse essenziell. Die CDU gestaltete nach dem Krieg maßgeblich diese in Europa verankerte, demokratische Bundesrepublik. Der Leitgedanke der FDP ist bis heute die Freiheit. Die Grünen forderten Lösungen, um die Zerstörung von Umwelt und Klima zu stoppen. Die AfD wurde zum Sammelbecken einer neuen Unzufriedenheit und Unsicherheit.
Und Wagenknecht? "Ein klares Narrativ kann ich noch nicht erkennen. Ich sehe da eher ein nostalgisches Projekt mit einem Blick auf gestern, angereichert mit verschiedenen Versatzstücken", so Rudolph. "Das wird noch deutlicher, wenn sie in ihren Reden nahezu jeden der alten Bundeskanzler lobt – von Ludwig Erhardt über Willy Brandt bis Helmut Kohl", sagt der Autor des "Philosophie-Magazins". Rudolph: "Erst mit Gerhard Schröder beginnen für sie die schrecklichen Kanzler, die abgehobenen Kabinette, die unsozialen Entscheidungen."
Wenn Wagenknecht die Rolle des Nationalstaates betont und den Vorrang einer Sozialpolitik, die auf die Bedürfnisse der im Nationalstaat lebenden Menschen fokussiert ist, bedient sie eher klassisch rechte Narrative. Dazu passt, dass sie die Europäische Union eher skeptisch sieht, die Globalisierung und multinationale Großkonzerne sowieso, kleine Betriebe und der Mittelstand genießen bei ihr Vorrang. Auch mit ihrer Kritik an einer diskriminierungsfreien Sprache, umgangssprachlich Gendern genannt, wird sie eher bei klassisch konservativen Menschen punkten. "Sie kritisiert den wachsenden Vorschriftenkatalog für korrektes Sprechen, Essen, Autofahren und Heizen", so Moritz Rudolph.
Wagenknecht wendet sich gegen westliches Sendungsbewusstsein, spricht sich gegen eine weltweite Unterstützung von Demokratisierungsprozessen aus, die sie als Einmischungen in fremde Angelegenheiten bezeichnet – selbst wenn es sich wie im Fall der Ukraine oder Taiwans um klare Aggressionen oder Angriffsdrohungen handelt. Sie bevorzugt eine isolationistische Haltung, was zum Beispiel auch den Austritt aus Verteidigungsbündnissen wie der Nato bedeuten würde. All das sind AfD-Positionen, auch wenn Rudolph betont, "dass sich Wagenknecht von der Rechtspartei schärfer abgrenzt, als viele CDU-Politiker".
Der Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke ist im Umgang mit Wagenknecht weniger gnädig: "Vor allem ist der wagenknechtsche Populismus eines: reaktionär. Sie gibt all jenen Zucker, die wollen, dass alles so bleibt, wie es früher einmal war – in der vermeintlich guten alten Zeit, als der Nationalstaat noch alles regeln sollte. Und genau mit dieser Sehnsucht nach der Vergangenheit buhlt sie um die potenziellen Wählerinnen und Wähler der AfD."