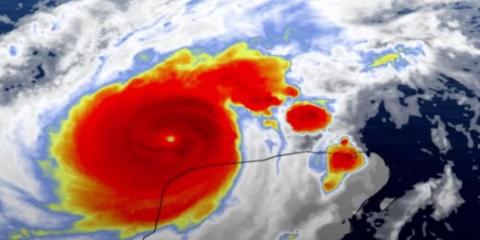Die unionistische Politik setzte große Geschütze gegen Bidens Besuch ein. Die ehemalige Parteivorsitzende der Demokratischen Union, Arlene Foster, kann ziemlich pragmatisch sein. Am Mittwoch erklärte sogar sie, dass er "das Vereinigte Königreich hasst". Ihr ehemaliger Stellvertreter, Nigel Dodds, entließ den Präsidenten als "offensichtlich pro-nationalistisch". Wie vorherzusehen war, schlug der DUP-Abgeordnete für East Antrim, Sammy Wilson, einen noch dunkleren Zweck vor, indem er Biden nicht nur beschuldigte, "anti-britisch" und "pro-republikanisch" zu sein, sondern "zu versuchen, das Vereinigte Königreich dazu zu zwingen, sich in die USA einzufügen".
Es wäre leicht, diese Angriffe abzutun und sie einfach als Schreie der Gewerkschafter zu behandeln, deren einstige Hegemonie in der nordirischen Politik geschwunden ist. Diese historische Verschiebung im Vermögen der Gewerkschafter ist hier sicherlich ein Faktor. Die Angriffe auf Biden sollten jedoch an sich ernst genommen werden. Sie sprechen über den Mangel an Vertrauen, der die nordirische Politik noch immer durchdringt, ein Vierteljahrhundert nachdem das Karfreitagsabkommen 30 Jahre der Unruhen beendet hat.
Eine unmittelbare Erklärung für die Sprache gegen Biden ist, dass am 18. Mai die Glaubwürdigkeit der DUP bei den Kommunalwahlen in Nordirland auf dem Spiel steht. Einerseits ist die Partei verzweifelt, sich nicht dem Druck zu beugen, die Machtteilung wieder aufzunehmen, und findet sich bei den Wahlen von Gruppen wie Traditional Unionist Voice "nicht gewerkschaftlich organisiert". Andererseits sucht sie nach großen Gewinnen und einer starken Wahlbeteiligung in gewerkschaftlich organisierten Gebieten, die ihre Kampagne gegen Premier Rishi Sunaks umgestaltete Post-Brexit-Pläne stärken und es der Partei ermöglichen werden, aus einer Position größerer Stärke wieder in die Machtteilung einzusteigen. Bidens Besuch hat eine große Plattform für eine Wahl geboten, die erhebliche Konsequenzen haben wird. Niemand erwartet, dass Machtteilung erst nach diesen Wahlen auf der Tagesordnung steht.
Aber eine zweite Erklärung für die Feindseligkeit ist das zweideutige und anachronistische Narrativ über das Irentum, in das sich dieser Präsident einhüllt und das er jetzt in die irische Republik übernommen hat. Bidens Selbstidentifikation als irisch-amerikanischer Präsidenten ist von zentraler Bedeutung für seine Politik. Seine irische Abstammung ist eine Tatsache. Zufällig ist das auch seine englische Abstammung, auf die er sich, sehr ungewöhnlich und sicher auf diplomatischen Rat hin, bezog, als er am Mittwoch an der Ulster University in Belfast sprach. Aber es ist das Irischsein, mit dem er sich identifiziert, nicht das Englischsein, und seine besondere Version des Irischseins ist voll von Geschichten und Kulturen, die im 21. Jahrhundert schwächer werden.
Briten- und Engländerfeindlichkeit – der Hauptvorwurf der DUP – gehört dazu. Tatsächlich nimmt in Irland selbst, obwohl man es nicht zu stark vereinfachen sollte, die anti-britische Stimmung ab, oder war es bis zum Brexit. Trotzdem ist es nur ein Teil von etwas Größerem. Wie Fintan O’Toole diese Woche argumentierte , stammt Biden aus einer irisch-amerikanischen Familie, einer Priesterschule, die in den USA immer noch idealistischen Einfluss ausübt, von der sich das moderne Irland jedoch entschieden entfernt hat, nicht zuletzt aufgrund von Kindesmissbrauchsskandalen. Dieses altkatholische Irischsein war tatsächlich eine der Ursachen des Konflikts im 20. Jahrhundert, dessen pragmatisches Ende Biden in Irland jährt.
Auf einer gewissen Ebene versteht Biden sicherlich, dass sich das katholische Irland zu seinen Lebzeiten unwiderruflich verändert hat. In ähnlicher Weise sieht er sicherlich auch, dass ein Großbritannien mit einem hinduistischen Premierminister nicht genau dasselbe ist wie das Großbritannien der Hungersnot oder der Black and Tans. Biden hat die BBC im Wahlkampf im Jahr 2020 beiseite geschoben, indem er sagte, er brauche nicht mit ihr zu sprechen, weil er Ire sei. Doch die DUP zieht aus solchen Anekdoten historisch unflexible Schlüsse.
Der öffentliche Biden ist vor allem ein sehr erfahrener Politiker. Er hat seine ganze Karriere damit verbracht, Abkommen auszuhandeln, um Gesetze so pragmatisch wie möglich mit Gegnern durchzusetzen. Darin ist er ziemlich gut. Er ist zweifellos leicht zu unterschätzen, teils wegen seines Alters und teils wegen eines Sprechstils, der von seiner Entschlossenheit geprägt ist, sein Stottern zu überwinden. Aber ein Leben auf dem Capitol Hill und im Weißen Haus bedeutet, dass er gut und nicht schlecht gerüstet ist, um die Feinheiten und Ängste Nordirlands zu verstehen.
Das zeigte seine Konversationsrede in Belfast. Es war sicherlich keine Rede für die Ewigkeit. Aber es las die Ungewissheit des Raumes richtig. Es war im Wesentlichen optimistisch und stellte die USA als Ermöglicher des Fortschritts dar. Aber es sagte absolut nichts über den irischen Nationalismus oder die Wiedervereinigung aus. Da war überhaupt keine Parteilichkeit dabei. Es zeigte sich, dass Biden – und sein Redenschreiber – das große Ganze und die Feinheiten Nordirlands viel besser erfassen, als die Kritiker behaupten.
Der Versuch der DUP diese Woche, Biden als einen sich einmischenden irischen Nationalisten hinzustellen, ist einfach falsch. Es hilft niemandem, dies vorzutäuschen. Es besteht kein Zweifel, dass Washington und London es vorgezogen hätten, wenn der 25. Jahrestag der Machtteilung ausgelassener gewesen wäre. Aber die Schuld daran liegt nicht bei dem Mann im Weißen Haus. Es liegt bei denen, die den Stillstand des Friedensprozesses nach dem Brexit geschaffen haben, aber überhaupt keine Strategie haben, ihn zu beenden.
dp/ket/pcl/gu