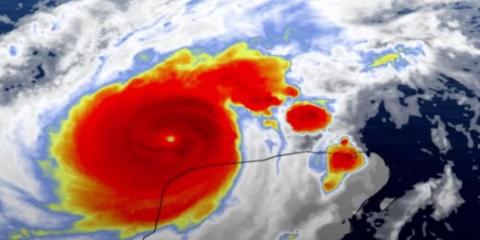Im Zuge eines Normalisierungsprozesses war eigentlich geplant, dass Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu Anfang November die Türkei besucht. Als Folge des Gaza-Krieges hat Erdogan jetzt aber den Kontakt zu Netanjahu abgebrochen. "Netanjahu ist für uns keine Art von Gesprächspartner mehr. Wir haben ihn gelöscht, wir haben ihn durchgestrichen", sagte Erdogan laut einer Mitteilung seines Pressebüros. Ankara beabsichtige allerdings nicht, die diplomatischen Beziehungen zu Israel abzubrechen.
Bereits in der Vergangenheit hatte Erdogan Israel aufgrund der Palästinenserpolitik etwa als "terroristischen Staat" bezeichnet und sich immer wieder als Verfechter der palästinensischen Sache inszeniert. Die Israelkritik aus dem Munde des Staatsoberhauptes eines Nato-Mitglieds markiert eine Zäsur: Sie kommt im Anschluss an eine jahrelange mühsam vorangetriebene Wiederannäherung zwischen Israel und der Türkei. Erst vor etwa einem Jahr wurden Botschafter ausgetauscht.
Als Reaktion auf Erdogans kürzliche Erklärung, die Hamas sei keine Terror-, sondern eine Befreiungsorganisation zog Israel seine Diplomaten prompt ab. Die Annäherung, von der auch die Türkei wirtschaftlich zu profitieren hoffte, scheint vorerst Geschichte. Dabei hätte Erdogan gern gefragter Vermittler sein wollen, ähnlich wie im Ukrainekrieg. Ankara hätte die erforderlichen Kanäle zur Hamas. Erst im Juli dieses Jahres war deren Chef, Ismail Hanija, zu Gast in der Türkei. Die Islamisten sollen zudem in Ankara Büros unterhalten.
Doch der Versuch scheint gescheitert. Die Vermittlerrolle haben derzeit Ägypten und Katar inne. "Wenn die Hamas Israel bekämpfen will, wendet sie sich an den Iran. Wenn sie Frieden wollen, wenden sie sich an Ägypten. Wenn es finanzielle Mittel benötigt, wendet es sich an Katar", sagt der Experte Salim Cevik. Die Türkei habe kaum Bedeutung. Die scharfen Töne Erdogans könnten auch ein Ausdruck von Frust über diesen Ausschluss sein. "Daher sucht er eine andere Position, indem er sich als Beschützer der sunnitischen Muslime präsentiert", sagt Cevik.
Erdogan braucht die internationale Bühne. Sein Erfolg bei Wählern baut seit jeher auf sein Image als international mächtiger und gefragter Politiker. Hinzu kommt, dass der türkische Staatschef mit seiner Kritik auch eine propalästinensische Tendenz in der Bevölkerung bedient. Erdogan befürchte, einen Teil seiner Basis an andere konservative Parteien zu verlieren, die allesamt schärfste Töne gegen Israel anschlagen, sagt Cevik.
Der Chef der mitregierenden ultranationalistischen MHP etwa fordert unverhohlen, türkische Soldaten nach Gaza zu schicken. Der islamistische Partner, die Partei Hüda Par, fordert die Schließung des etwa von der US Air Force genutzten Luftwaffenstützpunktes Incirlik in der Südtürkei. Erdogan verfügt seit den Wahlen dieses Jahres nur über eine dünne Mehrheit. Die gilt es vor dem Hintergrund der anstehenden Regionalwahlen im März 2024 zu wahren.
Erdogans Aussagen stechen hervor. Aus den Golfstaaten etwa kamen mehrheitlich diplomatischere Töne. Dass der türkische Präsident den Konflikt ernsthaft weiter eskalieren lassen will, ist jedoch mehr als unwahrscheinlich. Immer wieder ruft er auch zu einem Waffenstillstand und Friedensverhandlungen auf. Der Westen scheint den Staatschef des Nato-Landes bisher großteils zu ignorieren. Für Mitte November ist dann ein Besuch Erdogans in Deutschland geplant. Offiziell ist die Visite noch nicht bestätigt, in Regierungskreisen in Ankara ist aber vom 17. und 18. November die Rede – am Abend des zweiten Tages steht im Berliner Olympiastadion ein Länderspiel zwischen Deutschland und der Türkei an.
Die Bundesregierung stellt Erdogans Haltung vor ein Dilemma. Einerseits muss sie befürchten, dass Erdogan mit seiner antiisraelischen Rhetorik auch in Berlin nicht hinterm Berg hält. Andererseits braucht sie Erdogan etwa bei der Neuauflage des Migrationsabkommens, und bei allen Krisen der vergangenen Jahre sind Deutschland und die Türkei eng verbunden – dafür sorgen allein die rund drei Millionen Menschen mit türkischem Migrationshintergrund hierzulande. Wie sehr der Westen auf Erdogan angewiesen ist, hat sich zuletzt bei dessen Blockade des Nato-Beitritts Schwedens gezeigt. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte Erdogan nach dessen Wahlsieg Ende Mai eingeladen.
Kritik an Erdogan gibt es in Berlin vor dem Besuch über Parteigrenzen hinweg. Die türkischstämmigen Abgeordneten Serap Güler (CDU) und Macit Karaahmetoglu (SPD) sprechen sich dennoch gegen eine Absage aus. "Ich glaube, eine Ausladung kann in der jetzigen Situation auch Wasser auf die Mühlen von Erdogan sein und dazu beitragen, dass er weiter gegen den Westen hetzt", sagte Güler. "Dennoch müssen wir Erdogan nicht den roten Teppich ausrollen." Der Besuch müsse an klare Forderungen geknüpft werden.
"Scholz muss Erdogan gegenüber klarmachen, dass seine Hetze gegen Israel für uns absolut inakzeptabel ist und wir darauf bestehen, dass er nichts von dem wiederholt", forderte Güler. "Eine gemeinsame Pressekonferenz sollte es nur geben, wenn Erdogan dazu bereit ist, die Hamas als eine Terrororganisation zu bezeichnen." Die Bundesregierung müsse darauf bestehen, dass Erdogan nur offizielle Termine wahrnimmt. "Wir wünschen keine Veranstaltung oder Ähnliches mit der hiesigen türkischen Community und ihm." Die CDU-Abgeordneten sprach sich dafür aus, dass Scholz Erdogan zu einem Besuch in einer KZ-Gedenkstätte einlädt.
Karaahmetoglu, der zugleich Präsident der Deutsch-Türkischen Gesellschaft ist, sagte: "Erdogans Entgleisungen sind ein neuer Tiefpunkt seiner Kommunikation. Er verharmlost das Morden und Abschlachten der Hamas. Das ist mit nichts zu entschuldigen, schon gar nicht dem anstehenden Kommunalwahlkampf, in dem gerade fast alle türkischen Parteien israelkritische Töne anschlagen. Wie verwerflich seine Aussagen sind, muss ihm der Bundeskanzler bei seinem Besuch aufzeigen, weshalb ich auch dafür bin, dass dieser stattfindet." Die Türkei unter Erdogan sei eine schwierige, aber sehr wichtige Partnerin.
Den Besuch des Länderspiels am 18. November dürfte Erdogan sich kaum entgehen lassen, sollte er dann tatsächlich in Berlin sein. Der Jubel vieler Landsleute im Olympiastadion dürfte ihm sicher sein, unter Deutschtürken hat Erdogan proportional noch mehr Anhänger als in der Heimat. Der Sprecher der Berliner Polizeigewerkschaft GdP in Berlin, Benjamin Jendro, schrieb auf der Plattform X (vormals Twitter): "Ein Großeinsatz, beim Besuch des türkischen Präsidenten sind stets besondere Sicherheitsvorkehrungen nötig." Mit Blick auf das Spiel fügte Jendro hinzu: "Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, könnten Sie Erdogan bitten, das zu Hause vorm Fernseher zu schauen?"