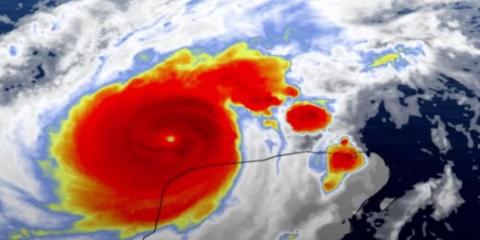Das Beispiel zeigt: Lulas Politik ist ebenso bemerkenswert wie widersprüchlich. Die einflussreiche Tageszeitung "Folha" kommentierte diese Woche vor Beginn der Weltklimakonferenz in Dubai, dass es zwischen dem, was Lula international ankündige, und dem, was er dann wirklich entscheide, eine große Differenz gebe. Das trifft auch auf das Thema fossile Brennstoffe zu.
"Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns beteiligen, weil wir die Erdöl produzierenden Länder davon überzeugen müssen, dass sie sich auf das Ende der fossilen Brennstoffe vorbereiten müssen", begründete Lula da Silva in dieser Woche den Beitritt zum Bündnis der Erdöl produzierenden Länder Opec. Er wolle diese Länder überzeugen, dass sie das Geld, das sie mit Öl verdienen, nutzen und Investitionen tätigen, damit ein Kontinent wie Afrika oder Lateinamerika die erneuerbaren Brennstoffe produzieren kann, die sie brauchen.
Ein Blick nach Brasilien aber verrät, Lula selbst geht nicht mit gutem Beispiel voran. Der von der Regierung kontrollierte staatliche Erdölkonzern Petrobras investiert zur Enttäuschung der Umwelt- und Klimaschützer nur 11 Prozent der für den Zeitraum 2024 bis 2028 vorgesehenen Investitionen in Höhe von rund 100 Milliarden US Dollar in die Energiewende und die Dekarbonisierung. Dem entgegenhalten kann Brasilien aber, dass das Land schon jetzt mehr als die Hälfte seines Energiebedarfs aus erneuerbaren Energien decken kann. Im Vergleich zu Deutschland, dass trotz Energiewende auf umstrittene Kohleimporte aus Kolumbien setzt, ist Brasilien damit ein gutes Stück voraus.
Lulas Umweltbilanz ist umstritten. Wie unter seinem rechtspopulistischen Vorgänger Jair Bolsonaro werden in Rekordtempo und ‑umfang Pestizide – von Umweltschützern Agrargifte genannt – zugelassen. Die Lula-Regierung plant ausgerechnet in der Amazonasregion neue, hochumstrittene Erdölförderprojekte.
Außenpolitisch hat Lula da Silva Brasilien aus der Isolation nach der dunklen Bolsonaro-Ära geholt. Das Land hat derzeit zahlreiche Schlüsselfunktionen inne: Vorsitz im Mercosur-Bündnis, der im Idealfall in dieser Woche mit der Bekanntgabe des erfolgreichen Abschlusses der Verhandlungen über den EU-Mercosur-Freihandelsvertrag endet. Nahezu übergangslos übernimmt Brasilien den G20-Vorsitz und hat eine Schlüsselrolle im UN-Sicherheitsrat. Deswegen gilt Lula als möglicher Vermittler in internationalen Konflikten wie aktuell im Nahen Osten.
Zuletzt kritisierte er allerdings Israel scharf und warf Jerusalem vor, für einen Völkermord in Gaza verantwortlich zu sein. Zwischen Brasilia und Jerusalem knistert es deswegen auf diplomatischem Parkett. Auch nach dem russischen Überfall auf die Ukraine kritisierte Lula zur Überraschung und Enttäuschung des Westens die Ukraine als mitverantwortlich für die Invasion.
Nach knapp einem Jahr im Amt ist die internationale wie die heimische Euphorie verflogen. Das alles hat Konsequenzen: Vor einer Woche meldete sich das Bolsonaro-Lager erstmals mit einer Großveranstaltung in São Paulo zurück. Zuletzt sank die Zustimmungsrate für den Politiker spürbar, der Brasilien in diesem Jahrhundert mit seiner inzwischen dritten Präsidentschaft wie kein anderer prägte. Auch innenpolitisch bewegt sich Lula auf umstrittenen Pfaden. Der Oberste Gerichtshof (STF) ist maßgeblich mit Richtern besetzt, die Lula da Silva (2002 bis 2010, 2023 bis 2027) oder seine Parteifreundin Dilma Rousseff (2010 bis 2016) in ihren Präsidentschaften auswählten.
Lula setzte durch, dass sein persönlicher Rechtsanwalt, der ihn in den Korruptionsverfahren verteidigte, in das höchste juristische Gremium aufstieg. Nun will er auch Justizminister Flavio Dino als neuen Richter durchsetzen. Das ist deshalb bemerkenswert, weil die von Lula dominierte Justiz alle Korruptionsurteile gegen ihn und weitere Politiker aus der Vergangenheit einkassierte. Und nun will der STF sogar ein Urteil durchsetzen, das Medien künftig für Aussagen von Interviewpartnern mitverantwortlich machen will. Das würde bedeuten, dass in Interviews gemachte harte Vorwürfe von NGOs oder der Opposition zu rechtlichen Konsequenzen für die Medien führen könnten – und das ausgerechnet unter dem Präsidenten, der nach der dunklen Bolsonaro-Ära die brasilianische Demokratie retten will.